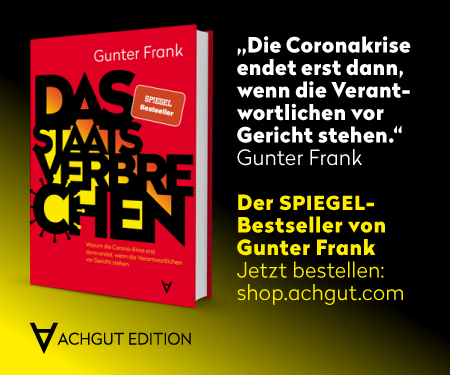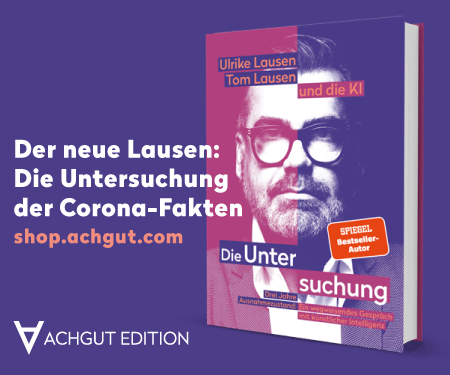Wunderbares Bild, wunderschöner Text, schrecklich die Kriege. Danke für Bild und Gedanken.
Ein Krieg ist schrecklich, da im Krieg bewaffnete Männer massenweise andere bewaffnete Männer töten, obwohl weder die ersteren noch die letzteren eine Schuld tragen. Viel schrecklicher ist aber der Frieden, in dem bewaffnete Männer unbewaffnete und wehrlose Männer und Frauen, Kinder und Greise aus ihren Wohnungen zerren und in der Dunkelheit verschwinden lassen; und während ein Krieg innerhalb einer absehbaren Zeit mit einem - mindestens - Waffenstillstand endet, kann das Reich des Horrors unbestimmte Zeiten dauern. Also jeder Krieg ist gerecht, wenn er den oben beschriebenen Frieden verhindert.
Das Bild gefällt mir sehr, ebenso das auf dem Buch: Höre auf ihre Stimme. Können wir Mut den Bildern und Büchern eine Ausstellung mal machen? Mit freundlichen Grüßen
Lieber Chaim Noll, Ihre Aufsätze auf „Achgut“ faszinieren stets durch spezifisch-intellektuellen Anspruch. Das gerade angesprochene Thema „Krieg“ - trotz Erkenntnisgewinn stets in humanitärer Katastrophe endend - soll scheinbar auf ewig die Menschheit begleiten? Gott gab den Menschen den Verstand, von Vernunft hat ER offensichtlich nichts gesagt!
Der Weltkrieg des Islam ist seit Jahrhunderten im Gange, die Schreckensmänner des Mohammed haben neben Öl nur diese Religion, deren Kern den Krieg lehrt, gegen Ungläubige. Wer das nicht begreifen will, darf gerne weiter seine Informationen von ARD, ZDF, Spiegel und SZ beziehen und glauben, dass Islam Frieden verspräche. Das macht er schon, aber nur für Muslime, nicht die Ungläubigen. “Unschwer ist zu erkennen, dass die Charakteristika der klassischen Rechten haargenau auf die Grundlagen-Texte des Islam zutreffen.” (Chaim Noll, Scharia und Smartphone, S. 326) Sie betonen ausgrenzende Unterschiede, Frauen sind ihre Äcker und Ungläubige dürfen Strafsteuern bezahlen. “Fremdenfeindlichkeit ist eine der Grundlagen des Koran, der Hadithe und der islamischen Gesetzestexte. Gegenüber Ungläubigen gilt keinerlei Toleranz. Sie sollen geschlagen oder getötet, wenigstens unterworfen und versklavt, im günstigsten Fall zu Schutzgeldzahlungen gezwungen werden. ” (Chaim Noll, ebenda, S. 326) Was erwarten wir von dieser Ideologie? Dass sie umdenken, sich in die Gegenwart bringen? Niemals! Israel führt den auf uns zukommenden Krieg schon jetzt. Und zeigt die leider alternative Antwort für diese Steinzeit-Barbaren.
Krieg muß man als “anthropologische Konstante” konstatieren. Die Neanderthaler verschwanden nicht einfach und nur so. Wieviel Krieg gibt es nicht schon in der Familie, mit den Nachbarn usw.. Leider, leider—aber so ist’s nun einmal. Worin die Menschen, wie mir scheint, den Tieren überlegen sind, das ist ihre keine Grenzen kennende Grausamkeit.
“Es ist ein Zur-Kenntnis-Nehmen des Krieges, ohne ihn zu beurteilen .Wir haben miterlebt, wie dieser Krieg unserem Land aufgezwungen wurde, wir sehen keinen Grund, ihn zu verurteilen, doch deshalb bleibt er, was jeder Krieg ist: eine Katastrophe.” . Könnte ein O-Ton einer Straßenumfrage in Moskau sein ...
Ich bin ganz bei Ihnen Chaim. Man müßte noch auf die offiziellen und offiziösen Reaktionen auf Kriegsgeschehen eingehen. Da fällt mir die Sowjet - und Rußland - “Expertin” Krone - Schmalz ein - ich hatte sie mal früher “die Behelmte ” genannt. Sie tingelt wieder mal auf allen Kanälen herum, weil die Sender der Meinung sind, sie als ehem. Moskau - Korrespondentin müßte ja mal was Objektives über den Staatsverbrecher Putin sagen können. ( Ich hatte sie mal vor Jahren Putins Schoßhündchen genannt.) Sie hatte schon als Sowjet - Korrespondentin nichts aber auch gar nichts von dem Sowjetsystem begriffen (Womöglich hat sie seinerzeit in Moskau sehr komfortabel gelebt; sicher nicht im berühmt - berüchtigten Hotel Lux ! ) Heute predigt sie davon, wie der Krieg Putins gegen die Ukraine hätte vermieden werden können. Sehr wahrscheinlich nimmt sie den Terminus “Überfall” nicht in den Mund… Bitte, liebe Leser, fallen Sie nicht auf sie rein !!!
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.