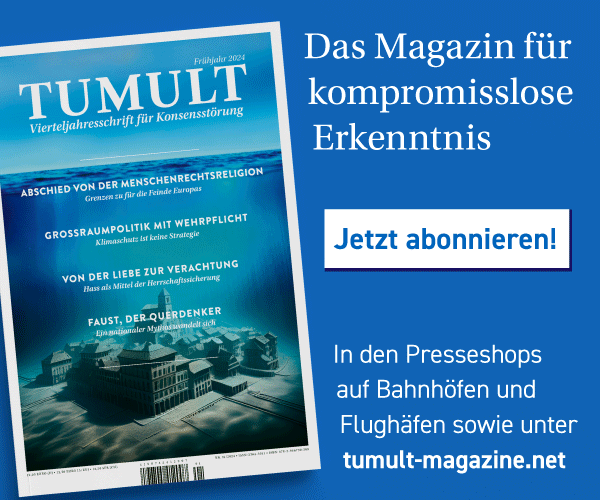Mit Friedensmissionen bewirken wir Kriege, Bürgerkriege und Terroraktionen. Wir investieren Milliarden in das Gesundheitswesen und erhöhen die Zahl der Kranken. Wir stecken Milliarden in den Ausbau von Straßen und produzieren Staus.
Die Professoren Dietrich Dörner, Jose Julio Gonzalez, Hartwig Eckert, Ines Heindl und Gunnar Heinsohn haben sich für das Buch „Zielverführung“ zusammengetan, um der Frage nachzugehen, warum wir in komplexen Systemen – also allen gesellschaftspolitischen – unter großem Aufwand das Gegenteil von dem erreichen, was wir als Ziel definiert haben. Achgut.com veröffentlicht Auszüge in einer neuen Serie.
Von Hartwig Eckert.
Es gibt nichts Wichtigeres, als bei Projekten die Ziele klar zu definieren. Es gibt nichts Nachteiligeres, als genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was als Ziel angestrebt wird. Zur Analyse dieser beiden Pole haben wir die Begriffe „telisch“ und „antitelisch“ geprägt. In allen dynamisch-komplexen Systemen ist antitelisches Verhalten paradoxerweise nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.
Wir heutigen Menschen leben in einer vernetzten, globalisierten Welt, in der Maßnahmen immer zahlreiche Nebenwirkungen und langfristige Folgen haben. Für die Evolution war diese rasante Entwicklung zu kurz, um in Homo sapiens genetisch verankerte neuartige Denkfähigkeiten hervorzubringen. Die Denkmuster, mit denen wir ausgerüstet sind, reichen aus für Detail-Komplexität, wirken jedoch bei dynamischer Systemkomplexität so, dass genau das Gegenteil des angestrebten Ziels erreicht wird. Die Lösung sehen wir in heuristischen Methoden zur Erkennung dieser Muster und in Denk- sowie Handlungsstrategien zur Überwindung des Dilemmas, dynamische Komplexität mit linearen Denkmustern lösen zu wollen.
Uns geht es nicht primär darum, welche Politiker beziehungsweise andere Stakeholder unserer Gesellschaft „Recht haben“, sondern um die Fragen, welche Ziele sie definiert haben und ob dabei die wichtigsten Variablen einbezogen wurden, auch die der Vernetzung, Langzeiteffekte und Nebenwirkungen. Wie kann man Politiker und andere Entscheidungsträger dazu bewegen, dass sie Ziele klar definieren und sie anschließend verfolgen, statt sich von ihnen zu entfernen? Wir brauchen „Zielweisheit“.
Aber warum gibt es so viele Individuen, Gruppen und Gesellschaften, die ihr Ziel formulieren, und deren anschließendes Verhalten sie dann so radikal von diesem Ziel entfernt, als strebten sie genau das Gegenteil an?
In London wütete 1665 und 1666 die Pest, die hauptsächlich von auf Ratten lebenden Flöhen übertragen wurde. In Gegenden mit großer Rattenpopulation sammelten sich besonders viele ihrer Beutegreifer, nämlich Katzen an. Da diese größeren und weniger scheuen Tiere mehr auffielen als die Ratten, tötete man alle Katzen als vermeintliche Überträger der Pest. Hunderttausend Menschen starben durch diesen Rettungsversuch. Dreieinhalb Jahrhunderte und viele Nobelpreise später fällt es schwerer, Unwissenheit als Entschuldigungsgrund für Handlungsweisen anzuführen, die das Gegenteil des definierten Ziels bewirken. Seltener geworden sind sie darum nicht.
„Willst du Rüstungsaufträge, so finanziere Friedenskonferenzen.“
Wir führen folgendes Begriffspaar ein: Wenn das definierte Ziel (griechisch „Telos“) die Bekämpfung der Pest ist, dann bezeichnen wir die Tötung von Ratten als telische Verhaltensweise, und die Tötung von Katzen als antitelische Verhaltensweise.
Trotz des Wissenszuwachses auf allen Gebieten beschränken sich antitelische Verhaltensweisen heute nicht auf relativ unwichtige Handlungen mit reversiblen Konsequenzen, wie z. B. wenn man den Schuh besonders gut zuschnüren will und dabei den Schnürsenkelzerreißt. Sie sind verstärkt in komplexen Systemen anzutreffen. Alle gesellschaftspolitischen Projekte zeichnen sich durch dynamische Komplexität aus.
Beispiele für antitelische Prozesse sind:
- wie aus dem Gesundheitswesen ein Krankheitswesen wurde,
- warum durch die Einführung des Prädikats „umweltfreundlich“ die Umweltschädlichkeit gefördert wurde,
- wie politische Maßnahmen gegen Luftverschmutzung in Städten dort zur Erhöhung der Luftverschmutzung führten,
- wie Kredite an Länder mit dem Ziel des Abbaus von Verpflichtungen zur Erhöhung ihrer Schulden führten,
- wie Maßnahmen mit dem Ziel der Zeitersparnis zu Zeitnot und Stress führten,
- wie Friedensbemühungen zu Kriegen führten,
- wie militärische Siegesstrategien die Ursache für die Niederlage waren,
- wie Schlankheitsjournale Übergewicht förderten,
- wie aus moralischen Motiven böse Folgen entstanden.
Wir werden scheinbar paradoxe Formulierungen analysieren, wie „Sie zerstören das, was sie suchen, indem sie es finden.“ Oder „Willst du Rüstungsaufträge, so finanziere Friedenskonferenzen.“
Wir werden darlegen, warum in dynamisch-komplexen Systemen antitelisches Verhalten die Regel und nicht die Ausnahme ist, welche Stakeholder sich in demselben System telisch und welche sich antitelisch verhalten, mit welchen Methoden man Gefahren antitelischen Verhaltens minimieren kann.
Von der Metaebene aus betrachtet scheint antitelisches Verhalten absurd. Dennoch treffen die spontanen Antworten: „Mir würde so etwas nicht unterlaufen“ und „Das kann ja nur den Dümmsten passieren“ nicht zu und haben daher keinen Erklärungswert. Wenn wir also alle nicht vor diesem Verhalten gefeit sind, dann lohnt es sich, das Phänomen systematisch zu untersuchen und Experten mit den Kompetenzen auf ihren Gebieten heranzuziehen, reale Beispiele zu geben, Ursachen- und Motivforschung zu betreiben und Lösungen anzubieten.
Damit wir alle von demselben Phänomen sprechen, beginnen wir mit der Erläuterung unseres neuen Begriffspaares telisch versus antitelisch
Ein Mensch will auf ebenem Gelände möglichst rasch zum Bahnhof gehen. Der kürzesteund somit schnellste Weg liegt auf der Geraden zwischen den beiden Punkten A ( = Ausgangspunkt) und B (= Bahnhof). Diesen Weg wählt er, und daher nennen wir sein Verhalten telisch, das heißt zielgerichtet.
Telisch: Von dem Ausgangspunkt A bewegt sich ein Mensch auf dem kürzesten Weg zu seinem Zielpunkt dem Bahnhof. Von allen Richtungen, die er einschlagen kann, ist die Verlängerung dieser Geraden in die entgegengesetzte Richtung die ungünstigste. Sie bringt ihn am schnellsten von seinem Ziel ab. Wir prägen dafür den Begriff „antitelisch“, der eine Handlungsweise bezeichnet, die dem vorher formulierten Ziel diametral gegenüber liegt.
Antitelisch: Ein Mensch will von seinem Ausgangspukt A zum Zielpunkt B, dem Bahnhof. Er bewegt sich aber in der Bahnhofstraße in die entgegengesetzte Richtung vom Bahnhof weg.
Von A aus gibt es – definiert in Kompassgraden – 360 mögliche Richtungen. In der Fokussierung auf das Gegensatzpaar „telisch - antitelisch“ interessieren uns lediglich zwei dieser Richtungen: Diejenige, die zum Ziel führt, und die um 180 Grad gedrehte.
Da antitelisches Verhalten das Pessimum darstellt, ist es eine Teilmenge aller möglichen Fehler. Und die Unterscheidung zwischen telisch als dem Optimum, und antitelisch als dem Pessimum, ist innerhalb der Menge aller möglichen Verhaltensweisen die wichtigste.
Einem Volk Gutes tun und den Diktator absetzen? Vorsicht!
Dies ist keins Serie über „Alles, was schief geht.“ Einen Zug verpassen oder nur 80 Prozent des gesteckten Ziels erreichen: das passiert jedem im Leben, und der Wunsch, nie wieder einen Fehler zu begehen, ist der Königsweg zum Unglück (paradoxerweise ein Beispiel für antitelisches Verhalten).
In dynamisch-komplexen Systemen neigen wir alle zu Strategien, die antitelische Folgen zeitigen, weil uns die Evolution auf diese Aufgabe noch nicht lange genug hat vorbereiten können. Wenn man das erkannt hat, so besteht ein erster Schritt darin, nich immer wieder das Denkwerkzeug zur Lösung linearer Probleme auf dynamisch-komplexe Systeme anzuwenden.
Ein dynamisch-komplexes System ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet: In einem solchen System stehen alle Faktoren in einer Beziehung der Wechselseitigkeit: Sie sind alle miteinander vernetzt. Vernetzung bedeutet: Man kann nicht einen Faktor isoliert ändern. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf zahlreiche andere. Und jede Auswirkung ist Auslöser für weitere Veränderungen. Mit der Bezeichnung „dynamisch“ wird der zeitlichen Komponente Rechnung getragen: Viele Maßnahmen erreichen ihre Wirkung mit großer Verzögerung. Während dieser Zeit können ursprünglich nicht erkannte und nicht beabsichtigte Veränderungen auf anderen Gebieten als Nebenwirkungen eintreten. Beispiel für ein für ein dynamisch-komplexes System ist der Klimawandel.
Lineares Denken ist eindimensional. Es ist erfolgreich für isolierte Phänomene. Eine Maßnahme mit einer sofortigen Lösung: Den Kaffee umrühren, um die Milch zu verteilen. Es ist auch erfolgreich in Systemen mit Detailkomplexität: Ein Fahrrad ist ein komplexes System. Einige seiner Details können aber unabhängig voneinander betrachtet werden. Zum Beispiel: „Der Akku meiner Lampe am Fahrrad ist leer. Ich lade ihn wieder auf,“ Eine solche Maßnahme kann ich durchführen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, ob dann noch die Bremsen funktionieren.
Gefahren: Gefährlich ist der Versuch, in dynamisch-komplexe Systeme mit linearem Denken einzugreifen. Beispiel: Man will einem Volk Gutes tun und setzt den Diktator ab. Das kann sich antitelisch auswirken. Im Irak und in Nordafrika führten diese Maßnahmen nicht zu funktionierenden Demokratien, Frieden und Wohlstand, sondern zu Bürger- und Religionskriegen mit hunderttausenden von Toten, zu Terrorismus in jenen Ländern und in Europa, zu wirtschaftlichem Niedergang, dem Aufschwung organisierten Verbrechens, Konflikten unter Großmächten, und zur Flüchtlingskrise.
In der nächsten Folge lesen Sie: Welche Gründe gibt es, auf antitelischem Verhalten zu beharren, also einen falschen Weg fortzusetzen? Und warum geschieht dies trotz besserem Wissen so oft?
Diese Serie besteht aus Auszügen aus dem Buch „Zielverführung. Wer für alles eine Lösung weiß, hat die Probleme nicht verstanden.“ Herausgegeben von Hartwig Eckert und Jose Julio Gonzalez, Altan Verlag 2017, 82008 Unterhaching, ISBN 978-3-930472-51-2. Zu beziehen beim Verlag direkt oder hier bei Amazon.
Prof. Dr. Hartwig Eckert lehrt an der Europa-Universität Flensburg (EUF) Anglistik und Sprachwissenschaft
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7