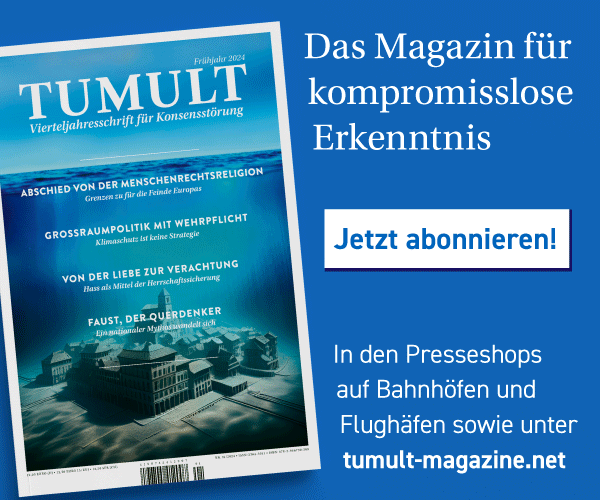@Hans-Peter Dollhopf - die Sozialversicherung, insbesondere die Rentenkassen, sind schon immer ein Schattenhaushalt der jeweiligen Bundesregierungen gewesen, aus denen man sich bei Bedarf durch Einlagerung versicherungsfremder Leistungen bediente
Auf Grund der Wahlversprechen der Mittelmäßigen auf Pump und so der Staatsverschuldungen kann die EZB, ohne (!) Erhöhung der Zinslast der Staaten und ohne (!) Rezession, die Zinsen nicht mehr erhöhen. Es ist die Politik, die EZB hat keine direkte Kontrolle über die Staatsausgaben! Draghi mit seiner Null-Zins-Politik und Geldschwemme wollte die 2% durch Investitionen getriebene, gute Inflation. Diese wurden nie erreicht, mangels Vertrauen in die Politik haben zu wenige investiert. Merke: WENN EINER 20% MEHR UMSATZ ERWARTET, DANN ZAHLT ER AUCH 10% ZINSEN, WENN EINER NICHT MEHR UMSATZ ERWARTET, DANN KANN MAN IHM GELD SCHENKEN, ER INVESTIERT NICHT! !! Sie sagten aber dann: Draghis Geldflut hat nicht zur Inflation geführt, wir können somit so weiter machen, dazu: Das nicht investierte Geld parkte sich in Sicherheiten wie langfristigen Staatsanleihen, die jetzt an der Börse für weniger gehandelt werden, jetzt (!) wird dieses Geld durch Flucht daraus wieder freigesetzt und schiebt die Inflation an. So erhöhen sie jetzt die Zinsen! Wurde unter Draghis Nullzinspolitik schon BEI UNS nicht investiert, so fallen jetzt bei höheren Zinsen auch noch die restlichen Investitionen weg … BEI UNS, denn: 135,5 Milliarden Euro Direktinvestitionen flossen 2022 aus Deutschland ab, nur noch rund 10,5 Milliarden Euro wurden von ausländischen Unternehmen in Deutschland investiert. Der IWF hat seine Prognose für das wirtschaftliche Wachstum veröffentlicht. Von allen gelisteten Ländern und Regionen hat Deutschland als einziges Land ein negatives Wachstum. Deutschland ist das Konjunkturschlusslicht: Die deutsche Wirtschaft droht weit hinter andere Regionen zurückzufallen. Und was folgt noch aus den höheren Zinsen? Laut Christian Lindner haben sich die Zinsausgaben im Bundeshaushalt in den vergangenen zwei Jahren verzehnfacht. Im Jahr 2021 hätten sich die Zinskosten noch auf 4 Milliarden Euro belaufen, nun seien es bereits 40 Milliarden Euro, das ist Geld, das an anderer Stelle fehlt.
@L. Bauer : >>Ja die Lisa Marie. Da schreibt sie doch so einen schönen europäischen promovierten Artikel, und dann beantwortet sie nicht einmal ihre eigene Frage.<< Also Lisa Marie würde ich in einer Generation ansiedeln, ich alter böser weißer Sack, wo man eigentlich keine Fragen beantwortet. Es geht darum, die wissenschaftliche Weltanschauung allen richtig zu erklären, sie abzuholen und mitzunehmen. Da würden Fragen nur stören. Ich habe keine Frage gesehen, hoab nix ghert, nix gwuust und nix gsegn! Wenn Sie schon mal versucht haben, mit dieser Generation eine Debatte zu führen, werden Sie bald gemerkt haben, dass alles Ihre Schuld ist, und wie klein hässlich und böse Sie alter Putin-Troll sind, Sie Feind der letzten Generation. Außerdem haben Sie sich alles nur ausgedacht, Behauptung, Behauptung Behauptung! Es mag ja einzelne Personen in dieser Generation geben, die sich ehrlich mühen, aber wir müssen da immer auf jähe Wendungen gefasst sein. Die ticken anders und wir werden es niemals verstehen. Im Prinzip liegt das daran, dass die keine Ahnung von nichts haben und alles falsch verstehen und verdreht deuten. Das ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Generation, aber diese ist völlig wehrlos der psychologischen Kriegsführung ausgesetzt von Geburt an. Eigentlich können sie nichts dafür, aber ich ja auch nicht. Zur Strafe übergeben wir denen einfach nicht die Ideale Welt, die ihnen zum Kaputtmachen verheißen wurde. Da sind die dann machtlos. Dann kleben Sie sich irgendwo fest oder sie verstehen das Wort Kunst falsch und beschmieren die Alten Meister mit Hundedreck. Aber sie bestehen darauf, dass Böhmermann Künstler ist, nicht Gullistorchler. Völlig verdreht. Aber da sind wir wieder machtlos. Wir müssen einfach zusehen, wie die gegen die Mauer rennen. Wir können ja immer noch rechtzeitig sterben, dann sehen wir das Elend nicht bis zum bitteren Ende. Und es wird bitter, dieses Ende.
Ich moechte bemerken, dass nicht die Schulden interessant sind, sondern deren Zinsen. Je hoeher die sind - durch hoehere Schulden -, desto geringer die Mittel fuer den sozialistischen, d.h. den entmuendigenden Staat, Irgendwann werden die vormaligen Adepten des “Sozialstaats” merken, dass sie dafuer zahlen zu arbeiten und dass man dem Staat auch das Geldwesen zu nehmen hat. Neben dem Gesundheits - und Bildungswesen und selbstverstaendlich der staatsgelenkten Presse. Ansonsten gilt fuer Deutschland: Vor lauter Sozialisten keine Demokraten. Selbstverschuldete Unmuendige, erwiesenermassen (“Pandemie”, “Impfung”) zu rund 80 Prozent im Bereich des Debilen.
Einfach mal “Geldmenge EZB” und/oder “Markus Krall” googeln, dann weiß man, wohin die Reise geht. Bald brennt die “Sicherung” durch… natürlich kann man den Luftballon immer weiter aufblasen und erstmal das Volksvermögen abschöpfen, aber da ist auch irgendwann Ende. Und auch die künstlich erzeugten Umsätze durch das neue Energiegesetz werden den Ballon nicht mehr retten können, da zuwenig Facharbeiter, die damit genug Umsatz-/Einkommenssteuer generieren können. Gehen Sie doch nur Lebensmittel oder Sprit kaufen, schauen Sie auch ihre Strom- und Gasabrechnungen an. Klar?
Jackson hole ist auf Kaputtland nicht anwendbar. Hier herrschen mind hole und Memory hole.
Wann hier alles um die Ohren fliegt, wann hier abgenippelt wird? Vermutlich dann, wenn die reale Wirtschaftsleistung so stark abgesunken ist, dass Korrumpierung, staatliche Privilegien, attraktive Postenversorgung und andere Extraleistungen für die mittlere Funktionärsschicht inklusive anderer systemrelevanter Protagonisten nicht mehr leistbar ist. Das war in der DDR auch so: die zunehmende Unzufriedenheit der bisher gepamperten Strukturen, führte zum Abfall vom Glauben und war letztendlich entscheidend.
Die einzige “Reservewährungen” sind natürlich vorkommrnde Ressourcen und Humanpotential, wobei es hierbei viel mehr auf die Qualität als auf die Quantität ankommt, und nicht irgendwelche bedruckten Scheinchen oder mit “0” oder “1” belegte Bits im unbegrenzten Datenkosmos. Aber wir glauben noch dran so wie an den Sieg beim Monopoly-Spielen bevor wir anfangen zu Würfeln.
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.