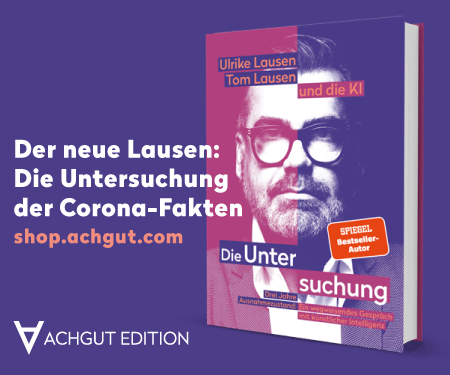Wie aus einem völlig normalen Schweizer ein Nazi wird und aus einem echten Nazi ein Widerstandskämpfer, lesen wir in der Prantl-Prawda. Sie berichtet über eine Personalie bei der WAZ:
“Bollmann war lange Jahre beim Verlag des Zürcher Tages-Anzeigers und dann bei des Basler Zeitung. Überall strich er haufenweise Jobs, überall klopfte er Sprüche.
Dennoch hielt es die Essener Funke-Mediengruppe Anfang Mai für eine gute Idee, ihn zum Verlagsgeschäftsführer zu machen und damit auch zum Verantwortlichen für die WAZ. [...]
Bei der Basler Zeitung sanierte Bollmann im Auftrag von Christoph Blocher, dem Eigentümer des Medienhauses, der in Deutschland vor allem als Rechtspopulist und Ausländerfeind bekannt ist. Blocher dominiert seit vielen Jahren mit der Schweizer Volkspartei die Politik, er fand nette Worte für die Apartheid in Südafrika und hetzt gegen die EU. Auch sein Adlatus Bollmann teilt offenbar dessen Positionen: ‘Es wäre für mich die absolute Horrorvorstellung, dass Schicksal meiner Kinder von den circa 50 000 Beamten in Brüssel bestimmen zu lassen.’ Unter Bollmann und Blocher wurde die Basler Zeitung zum Sprachrohr der Rechtspopulisten. Das, so befürchteten viele Redakteure in Essen, drohte nun auch der WAZ.
Es wäre eine unglaubliche Wendung der Geschichte gewesen. Gegründet wurde die Zeitung von Erich Brost und Jakob Funke. Brost war SPD-Mann und Journalist, die Nazis trieben ihn 1939 in die Emigration, nach England und nach Schweden. Sein Partner wurde Jakob Funke, der in der Nazizeit als Journalist für die amtliche Nachrichtenagentur des Dritten Reiches gearbeitet hat und deshalb im Hintergrund bleiben musste. Funke kümmerte sich also ums Finanzielle, Brost um die Richtung der Zeitung, die eine ziemlich Sozialdemokratische wurde.
Vom Widerstandkämpfer zum Blocher-Mann. Das wäre den Lesern im Ruhrgebiet nicht zuzumuten gewesen. Die Frage ist, warum man überhaupt auf die Idee gekommen war.”
Um mal den simpelsten Fehler in dem idiotischen Vergleich zu benennen: Wenn der waschechte Nazi* Funke “sich ums Finanzielle” kümmerte, war also niemals ein “Widerstandskämpfer” in der Funktion, die Bollmann als Verlagsgeschäftsführer hätte bekleiden sollen. Sondern ein ausgewiesener Nazi, der “deshalb im Hintergrund bleiben musste”, wie selbst das Neue Süddeutschland verschämt einräumen muss. Die Kinder des Nazis Funke erbten dessen Unternehmensanteile.
Dass der Schweizer Bollmann eine deutliche Skepsis gegen die EU hegt, nimmt man ihm in München übel. Als Beleg für irgendeine rechtsradikale Wirrköpfigkeit taugt diese Haltung natürlich nicht, wird sie doch von einer Mehrheit der schweizer Bevölkerung geteilt. (Eine Bevölkerung, die erstens klug genug ist, um einen Mindestlohn von 22 Franken stündlich bzw. 4.000 Franken monatlich in freier Wahl abzulehnen, und zweitens kapiert hat, dass der Luxus, solche Fragen überhaupt auf diesem Niveau diskutieren und entscheiden zu dürfen sehr viel damit zu tun hat, eben nicht in der EU zu sein.)
Nun hat auch der Arbeitgeber Bollmanns, die inzwischen fusionierte mit der Basler Zeitung fusionierte Basler “National-Zeitung” eine Geschichte. Was ging dort wohl so ab, als Funke Propaganda für die Nazis machte? Ein Artikel aus der Welt gibt Aufschluss:
“Nachvollziehen lässt sich all das auch und gerade in der Schweizer Publizistik und ihrer damaligen Funktion für das deutsche Exil. Eine wichtige solidarische Rolle spielte zum Beispiel die in Basel erscheinende ‘National-Zeitung’. Sie bot vielen aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei vertriebenen Feuilletonschreibern eine der wenigen deutschsprachigen Publikationsmöglichkeiten, die noch vorhanden waren: ‘Kein Blatt wird in den Prager Cafés jetzt eifriger verlangt als Ihre Nationalzeitung, auch auf der Straße wird Ihr Blatt viel gekauft. Als das letzte freie Wort in deutscher Sprache hat es eine Sonderstellung.’ Das schrieb Max Brod Anfang 1939 an den Feuilletonchef Otto Kleiber. Schon 1936 hatte sich auch Thomas Mann lobend geäußert: ‘Die Nationalzeitung bewährt, wie kein anderes Blatt, ein warmes Verhältnis für die trostlose Situation der deutschen Emigranten.’
Wenn man Kleibers Geschäftspost und Korrespondenz, die an der Universitätsbibliothek Basel verwahrt wird, einsieht, liest man nicht nur illustre Namen wie Alfred Polgar, Kurt Tucholsky oder Robert Musil. Es wird auch deutlich, dass die Rolle eines Zeitungsmachers, der denen Asyl gewährt, die anderswo nicht mehr publizieren können, weder trivial noch banal ist. Einerseits möchte man helfen. Andererseits wird man nicht alles, was angeboten wird, drucken können.
Exil hat immer mehrere Dimensionen: Schreibrestriktionen und Publikationsverbot sind das eine. Der Einkommensverlust das andere. Klassische Emigrantenzeitschriften waren finanziell meistens klamm, die Strukturen der Schweizer Presse hingegen waren gesund. Schon 1923, als die große Inflation in der Weimarer Republik manches Zeitungshonorar auf Witzgröße schrumpfen ließ, war Otto Kleibers Feuilleton-Redaktion eine beliebte Anlaufadresse geworden. Der Ansturm der Auswärtigen rief allerdings auch Neider auf den Plan: ‘Hoffentlich haben Sie trotz dem Andrang von Berliner Juden noch etwas Platz für verschnupfte Einheimische’, schrieb da zum Beispiel ein Schweizer, seinen Antisemitismus mehr ausstellend als verhehlend.”
Vom “letzten freien Wort in deutscher Sprache” während NS-Zeit hin zu einer Position, die von einem Nazi-Propagandisten bekleidet wurde (und aus der wunderschönen Schweiz ins Ruhrgebiet, dorthin, wo Deutschland am drittweltigsten ist): Das wäre wahrscheinlich auch Bollmann nicht zuzumuten gewesen. Die Frage ist, warum man überhaupt auf die Idee gekommen war.
*Wenig verwunderlich findet man auf die Schnelle nicht allzuviele Informationen über die Tätigkeit Funkes während der NS-Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass die amtliche Nachrichtenagentur des Dritten Reiches keine Nicht-Parteimitglieder beschäftigte. Für genauere Hinweise wäre ich dankbar!