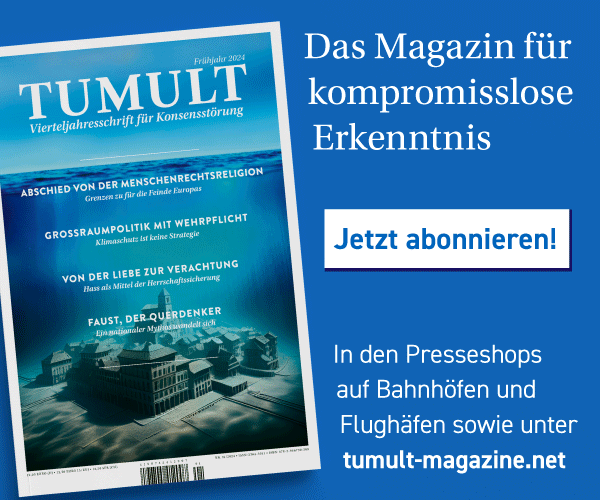Von Sascha Adamek.
Sieht man sich die Liste der weltweiten Konzerne mit Investoren aus Scharia-Staaten an, so stellt man fest, dass der Begriff der Scharia-Konformität offenbar sehr dehnbar ist. Denn wie sonst sollten Tourismus- und Hotelkonzerne, die vom Alkoholkonsum, über den Genuss von Schweinefleisch bis zu dem Glücksspiel und der Prostitution diverse Nebenerwerbe mit sich bringen, von mächtigen Staatsfonds und Investoren aus den strengsten Scharia-Staaten aufgekauft werden dürfen?
Deren Finanzmärkte weisen hohe Wachstumsraten von bis zu 20 Prozent auf. Um diesen Scharia-Kapitalismus auf Hochtouren weiter expandieren zu lassen, waren die Golfmonarchien und die von ihnen finanzierten islamischen Gelehrten kreativ. Denn sie hatten noch die spektakulären Konkurse islamischer Banken zwischen 1988 und 1991 vor Augen. Die waren damals an allzu strenger Auslegung des Investitionsverhaltens zugrunde gegangen.
Denn eigentlich sind nach der Scharia Investitionen in Unternehmen, die verbotene Güter wie Alkohol, Schweinefleisch, Waffen oder Drogen verkaufen oder Dienstleistungen wie Prostitution anbieten, verboten. Seit diesen Erfahrungen haben führende muslimische Gelehrte wie Tariq Ramadan und Yusuf al-Qaradawi eine neue Flexibilität bei der Auslegung der Scharia im Wirtschaftsleben entwickelt. Während die Salafisten vertreten, dass nur erlaubt ist, was der Koran und die Hadithen – die Tradition des Propheten (sunna) als kanonische Quellen – erlauben und alles verboten sei, was dort verboten werde, lautet das theologische Credo des Scharia-Kapitalismus, dass alles, was nicht ausdrücklich gegen Verbote verstößt, erlaubt ist – und nicht nur das.
Ralph Ghadban formuliert es so: „Die Mondlandung wie die Gentechnik, die Atombombe wie Penicillin sind in der Welt der islamischen Referenzen integrierbar. In der Fiqh-Sprache heißt es: Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt.“ Während Salafisten viele Dinge ihrer Umgebung ausschlössen, plädierten die Muslimbrüder für eine „vereinnahmende Haltung“. Und er fährt fort: „Die Integration bedeutet dann nicht die Integration der Muslime in den Westen, sondern die Integration des Westens in die Weltanschauung der Muslime, das heißt in das Scharia-System. […] Die Menschenrechte, die die Grundlage der westlichen Kultur bilden, werden nur im Rahmen der Scharia akzeptiert.“ Selbst wenn diese Verbote in der Praxis nur halbherzig umgesetzt werden, haben sie mittlerweile Eingang in das Denken und Handeln westlicher Banken gefunden. Am Ende geht es um symbolische „Geländegewinne“ und natürlich ums Geschäft .
Im Wirtschaftsleben ist die Flexibiliät weit größer als in gesellschaftlichen Belangen. So resultiert Ralph Ghadban zufolge die Flexibilität der Scharia aus einigen islamischen Prinzipien wie dem Gemeinwohl (maslaha) und der Notwendigkeit (darura). Nach der Definition des Altgelehrten al-Ghazali (1058 - 1111) handle es sich bei maslaha um die Bewahrung der fünf Prinzipien der Scharia: „der Bewahrung der Religion, ihres Lebens, ihres Verstandes, ihrer Nachkommenschaft und ihres Eigentums“. Die Notwendigkeit, die darura, wiederum erlaube es den Muslimen, „im Notfall klare Scharia-Vorschriften außer Kraft zu setzen, um die maslaha, das Allgemeinwohl der muslimischen Gemeinde, zu bewahren. Das Scharia-Prinzip besagt: Die Notwendigkeiten setzen die Verbote außer Kraft. Wenn zum Beispiel ein Schächten ohne Betäubung unmöglich ist, dann ist es rechtens, betäubte Tiere zu schächten.“
Muslimische Nachbarschaft ist wichtiger als Scharia-Finanzierung
Andererseits geht es den deutschen Akteuren der Muslimbruderschaft darum, die gläubigen Muslime in Deutschland auf den rechten Weg der Scharia-Vorschriften zu verweisen. Bei der Frage einer Eigenheimfinanzierung ist zum Beispiel der 2016 neugegründete Fatwa-Ausschuss Deutschland eindeutig. Er macht sich die entsprechende Fatwa des Europäischen Fatwa-Rates zu eigen. Der Rat greift auch sehr konsequent in das Privatleben von Muslimen ein.
Nicht nur nebenbei fordert der Rat sehr deutlich eine Anpassung der europäischen Bankenpraxis an islamische Gesetze: „Ebenso ruft er dazu auf, dass die islamischen Gesellschaft en in Europa mit den konventionellen europäischen Banken verhandeln, damit diese Geschäftsform in eine islamrechtlich akzeptierte Form umwandeln, wie den ›Bay’ at-Taqs.īt.‹ [Ratenkauf], bei dem der Preis im Gegenzug zur Fristverlängerung erhöht wird. Dies würde dazu führen, dass sie eine große Zahl von Muslimen gewinnen würden, die mit ihnen auf Basis dieser Methode geschäftlich verkehren würden.“
Wenn aber alle Stricke reißen und die Wahl einer schariakonformen Finanzierung den Erwerb eines familiären Eigenheimes verhindern würde, gilt laut dieser Fatwa das milde Gebot Allahs:
„Und Er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt.“ Die Autoren der Fatwa schreiben: „Die Notwendigkeit erlaubt das Verbotene“, so dass der muslimische Familienvorstand sich wieder entspannt zurücklehnen kann, wenn er am Ende doch auf eine übliche Immobilienfinanzierung zurückgreift . Denn der Fatwa-Ausschuss sieht in den religiösen Vorschriften auch einen übergeordneten Sinn: „Der Besitz des Eigenheims nimmt dem Muslim diese Sorge, so wie ihm dies die Wahl seines Eigenheims in der Nähe der Moschee, des islamischen Zentrums und der islamischen Schule ermöglicht. Dies verschafft der muslimischen Gemeinschaft ebenso die Möglichkeit, sich näherzukommen und Nachbarn voneinander zu werden. So lernen sich ihre Kinder kennen, ihre Bande wird gestärkt, und sie unterstützen sich in ihrem Alltag im Rahmen der islamischen Vorstellungen.“ Muslimische Kinder sollen also mit muslimischen Kindern aufwachsen, um ihre religiösen Bande zu stärken. Die Multikultur hat in diesem Denken leider keinen Platz.
Kapitalismus und Scharia Hand in Hand
Die Angelegenheit mit der Scharia ist also sowohl für die Konsumenten- als auch die Angebotsseite der Ökonomie recht einfach geregelt: Lässt sich ein Touristenresort nicht ohne Alkoholausschank profitabel führen, wird also Alkohol ausgeschenkt. Ist Schweinefleisch für den Erfolg eines Restaurants in bestimmten Kulturräumen der Welt unabdingbar, gibt es auch Schweinefleisch. Westliche Rüstungskonzerne und Banken behaupten schon immer die Notwendigkeit des internationalen Waffenhandels. Andere verteidigen die Unausweichlichkeit der Prostitution. Wenn es um die „Eigentumssicherung“ – sprich Profitmaximierung – geht, können auch muslimische Finanzakteure ganz oben mitmischen.
Letztlich können wir folgern, dient jede Form des Kapitalismus der Sicherung, eigentlich der Vermehrung des „Eigentums“ und somit auch der Nachkommenschaft. Scharia und Kapitalismus gehen Hand in Hand. Diese Praxis, so folgert der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban, entpuppe sich auf diese Weise schnell als ein opportunistisches System, weil sie kein ethisches System im Hintergrund erkennen lasse: „Es gibt kein ethisches System.“ Aber wie halten es die Gelehrten mit dem Teufelszeug der Zinsen? Denn wer sie nimmt, sollte nach dem Koran „nicht anders auferstehen als jemand, den Satan durch Berührung zum Wahnsinn getrieben hat“.
Auch für die Frage nach Zinsen und Renditen haben die Gelehrten eine pragmatische Regelung ersonnen. So gelten beispielsweise Mieten und Gewinnrenditen aus Investitionen nicht als Zinsen im verbotenen Sinne. Aber bedeutet das, dass Konzerne, an denen Investoren aus Scharia-Staaten beteiligt sind, sich sämtlicher Mittel klassischer Kreditfinanzierungen enthalten? Natürlich nicht! Auch hier gilt, was muss, das muss, und was immer schon so war, fällt unter den Scharia-Begriff des Gewohnheitsrechts urf. Zinserträge wurden einfach als nachrangig bezeichnet und zu sogenannten Gebühren umbenannt, um nicht gegen die Scharia zu verstoßen, beschreibt Ralph Ghadban: „So gelang es den islamischen Bankern, die Kontroverse um riba, den Zins, zu unterlaufen.“
Auszug aus dem Buch Scharia Kapitalismus. Den Kampf gegen unsere Freiheit finanzieren wir selbst von Sascha Adamek. In der dritten und letzten Folge lesen Sie am MIttwoch: Die „Saudi-Connection“ mitten in Berlin. Teil 1 dieses Dreiteilers finden Sie hier, Teil 2 hier, Teil 3 hier.
Sascha Adamek, geb. 1968, arbeitet seit zwanzig Jahren als Journalist und Filmemacher für die ARD, u.a. für die Politikmagazine „Kontraste“ und „Monitor“, aktuell für die Redaktion „Investigatives und Hintergrund“ des rbb.
.jpg)