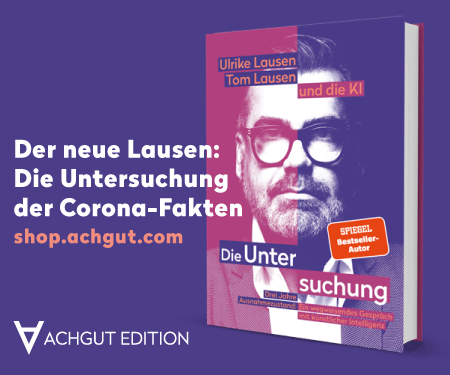Es ist doch eine zu schöne Geschichte, eine Geschichte von geradezu biblischer Moralhaftigkeit: Ein Land wird groß durch Fleiß, Dynamik und Offenheit. Dann aber entwickelt es Gier und Größenwahn und geht daran zugrunde. So geschieht es, glaubt man so ziemlich jedem europäischen Intellektuellen, Politiker oder Fahrradhändler im Prenzlauer Berg, den USA.
Autor Robert Lieber erzählt eine andere Geschichte - jene der obigen Geschichte selbst. In einem klugen Essay skizziert Lieber die Historie eines zentralen Bestandteils des Antiamerikanismus – dessen, was er „Declinism“ nennt: Er zeigt, wie gern sich Beobachter in aller Welt, aber auch in den USA selbst, schon immer mit dem direkt bevorstehenden Untergang Amerikas befassten. Im 18. Jahrhundert wusste man im royalen Europa sicher, dass das Projekt jenseits des Teiches nur scheitern konnte. Im 20. Jahrhundert waren sich links und rechts über das kommende Scheitern der USA und des westlichen, unvölkischen Kapitalismusmodells einig.
Momentan laufen die Thesenfließbänder der Deklinisten wieder auf Hochtouren. Alles Böse an der momentanen Krise wird für irgendwie aus den USA kommend gehalten. Zugleich entwickeln Betrachter die Illusion eines besseren, europäischen Wirtschaftsmodells. Die sklerotische Wandlungsunfähigkeit Europas und nicht zuletzt Deutschlands wird plötzlich zu klugem Skeptizismus hochgeredet. Kaum ein Beitrag, in dem nicht die „mahnenden“ Worte „Exzess“ und „Maß“ fallen.
Die momentane Debatte zeigt vor allem eines: Wie überaus wichtig die USA und die Idee von ihr für den europäischen, und womöglich auch für den chinesischen oder japanischen, Selbstfindungsprozess waren und sind. Speziell Europa entwickelt das Bild von sich selbst gern als Gegenmodell zu den USA. Oder es erarbeitet das Bild eines „besseren Amerika“, um es zu feiern und damit ein klareres Verständnis von sich selbst zu erhalten. (So funktionierte der Obama-Event vor der Siegessäule: Obamas echte politische Ideen wie ein verstärktes Engagement Deutschlands in Afghanistan störten die obamatisierten Studenten eher. Sobald aber abstrakte Signalbegriffe wie „piece“ oder „together“ fielen, wurde aufgeregt applaudiert, weil man sich darin wiederzufinden glaubte.)
Die USA sind für die Europäer, psychoanalytisch gesprochen, das Andere. Dasjenige, an dem man sich abarbeitet; mit dem man zwar irgendwie Probleme hat, ohne das man selbst aber auch nichts wäre. Insofern nur erfreulich für unsere Untergangsprediger, dass Lieber mit seinem Abschlussstatement recht behalten dürfte: „The critiques come and go. The object of their contempt never does.“