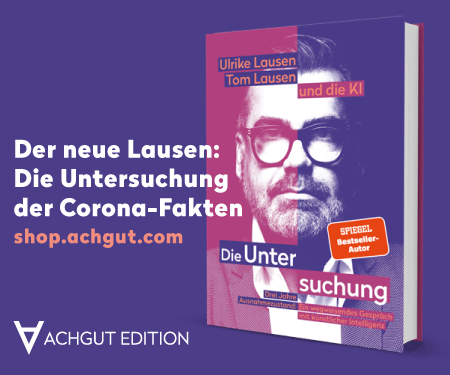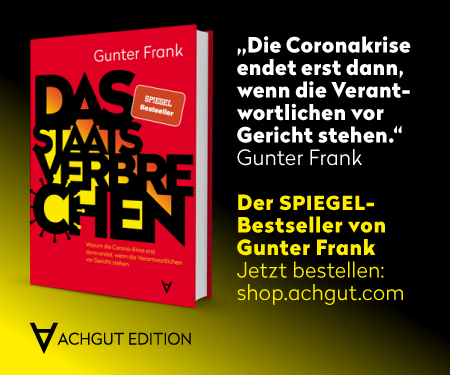Auch bei “ich-habe-mitgemacht.de” wird seit Monaten nichts Zusätzliches mehr dokumentiert. Ermüdung also auch hier.
Hallo zusammen, meine Hoffnung beruht auf den Anwälten in den USA, die sich dort wohl der Impfopfer annehmen werden. Deren Motive sind zwar vermutlich eher materiell dominiert, aber am Ende zählt das Ergebnis. Könnte sein, das dann ein Tsunami auch nach D rüberschwappt. Sich von den Amis retten zu lassen hat ja Tradition in D :=)
Zu “keine negativen Konsequenzen”, eben auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden: “56077 Koblenz: Tatoo termin frai”
Als damals die Empfehlung für ein „Impfabo“ öffentlich wurde reagierten vernunftbegabte: „Sapere aude“. Insofern geht jenen die Diskussion „links am Rektum vorbei“!
Karma is a bitch. Je Boostern, desto Nebenwirkung. Und viele wissen und fürchten das.
Wer sich hat ‘Impfen’ lassen, wer einen PCR Test hat machen lassen, wer keine Freunde zu sich eingeladen hat wärend der Maßnahmen, wer seinen Kinder erzählt hat das sie Oma und Opa umbringen wenn sie sie besuchen, wer einen krankhaften und jeder Wissenschaft wiedersprechenden Maskenfetisch entwickelt hat, wer auch nur eine Sekunde einer Merkel, einem Spahn, Lauterbach, Wieler, Drosten, und wie sie alle heißen, keine Lügen unterstellt hat, all diese Menschen haben mit ihrer Verantwortungslosigkeit diese Diktatur legitimiert. Will ich Selbstbestimmt und souveräner Bürger sein, dann muß ich auch so handeln. 90% der Bevölkerung haben aber signalisiert das sie jeden Scheiß mitmachen um nicht aus der Gnade der Knechtschaft zu fallen. Wir haben ein riesiges, psychologisches Problem in dieser Gesellschaft. Beispielhaft kann man hier die Medien und die Politik nennen. Wer solche Protagonisten und Agitatoren, die Hass und Feindbilder schaffen, nicht als Feinde von Demokratie und friedlichem Zusammenleben erkennt, bei dem ist das falsche Leben schon zum richtigen geworden. Das gilt für Corona, für den Ukraine Krieg, für die Klimahysterie, die Verleugnung der Korruption in der EU, und für alle anderen Themen und Krisen unserer Zeit. In einem Land in dem der Begriff ‘Freiheit’ von Tag zu Tag pervertiert wird, in dem man den Menschen jede Freiheit nimmt und sie zum bloßen Objekt, zum gehörigen Humankapital erzieht, in so einem System hat die Gehirnwäsche oberste Priorität. Destilliere ich die Begriffe Würde und Freiheit aus dem Grundgesetz und der Philosophie, und proklamiere sie in ihrem eigentlichen Sinne für eine demokratische Gesellschaft, dann bin ich ein Nazi. Und der Brandbeschleuniger für diese Art von Gesellschaftszersetzung waren die Merkel-, Söder-, Scholz- und Habeckwähler. Und all jene die die o.b. totalitären Maßnahmen wortlos über sich ergehen lassen haben.
Einen Arzt aus Leer der schrieb, man müsste die Ungeimpften aus dem eigenen Leben ausschließen und diese nicht mehr in die eigenen Häuser lassen, habe ich wegen Volksverhetzung angezeigt. Der OStA hat eine Strafverfolgung abgelehnt, deshalb bin ich so frei zu fordern, wir müssen Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Politiker und alle anderen Mitverantwortlichen aus unserem Leben ausschließen und ihnen das Leben so schwer wir möglich machen.
“Keine Antworten, keine Erklärung, keine Entschuldigung. Kein Dialog, kein Verstehen, kein Abschluss möglich. Jeder Versuch, etwas zu bereinigen, wird gnadenlos missachtet. So wie im Fall privater Trennungen läuft es auch bei der Aufarbeitung der verheerenden Corona-Politik: Die Verantwortlichen machen sich einfach dünne. (...) - denn unser Anteil ist und bleibt prozentual zu gering, und unser Schmerz ist ihnen ohnehin egal.”—- Unser “Schmerz ist denen keineswegs egal. Diese Psychopathen blühen umso stärker auf, je mehr wir offensichtlich leiden! Die Zersetzung Deutschlands und seiner - autochthonen - Bürger findet auch in den Seelen und Köpfen statt. Diese Form des Psychoterrors kann man auch so betrachten, dass die Machteliten darauf hoffen, dass das “Ghosten”, welches die Machteliten anwenden, von den Untertanen imitiert wird. Dadurch würde der “Pöbel” u.a. die Zersetzung der gewachsenen inner- und außerfamiliären Strukturen durchführen. Als Bild kann man sich das so vorstellen: Die Trachten der einfachen Bürger haben die teuren Kostüme der Adligen imitiert. Momentan hoffen die “Adligen”, also der skrupellose Zersetzungs-, Macht- und Geldadel, dass die Bürger im Kleinen massenweise das tun, was die “Adligen” an ihnen - also den prospektiv zu Versklavenden - vorexerzieren. - Die zu Massenversuchsuntermenschen degradierten Opfer - es sind weltweit Milliarden! - sollten lernen, nicht mit ihren Todfeinden zu kooperieren. Man muss dem elitären Abschaum dieser Welt mindestens den Rücken zukehren. Die Menschen müssen zusammenhalten und mit beiden Beinen auf der Erde stehen. - Der globale Hybridkrieg, der auch als Great Reset bezeichnet wird, findet innerhalb und außerhalb der Köpfe statt. Es geht um nichts weniger als um Tod, Leben, Freiheit und Versklavung. Es geht also um alles!
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.