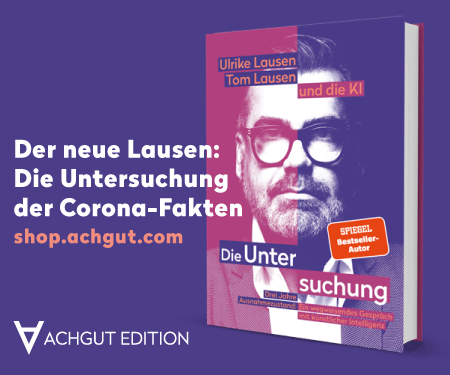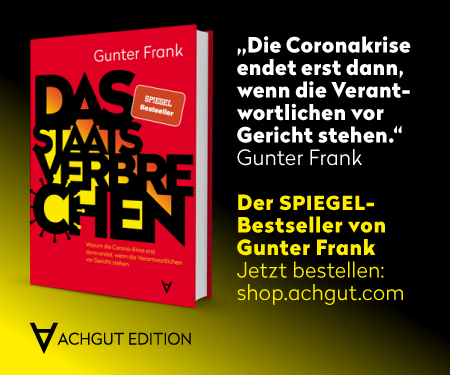US-Präsident Donald Trump trifft sich an der innerkoreanischen Grenze mit Nordkoreas Diktator Kim Jong un, Merkels Abkommen über die Rückweisung von Migranten erweisen sich als wirkungslos, der Bundeswehr werden immer höhere Milliardenbeträge fehlen, deutsche Krankenhäuser sind in der Krise, Niedersachsens Innenminister möchte SPD-Vorsitzender werden, während Parteienrechtler die Art, in der die Partei jetzt einen neuen Vorsitzenden kürt, für unzulässig hält.
US-Präsident Donald Trump ist in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea eingetroffen, meldet orf.at. Er wolle sich an der Demarkationslinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen.
Trump hatte das Treffen erst gestern via Twitter angeboten. In der Folge habe es eine hektische Last-Minute-Diplomatie gegeben, die offenbar zur Annahme der Einladung seitens Nordkoreas geführt habe.
Mehr als acht Millionen Venezolaner könnten Ende 2020 vor der Krise aus ihrer Heimat geflohen sein, meldet die Presse. Die Zahl von 8,2 Millionen Venezolanern außerhalb Venezuelas habe die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) auf ihrer Versammlung im kolumbianischen Medellín vorgelegt. Sie habe von „einer der größten Emigrationsbewegungen in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas“ gesprochen.
In einer Resolution appelliere die OAS an „Staaten, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, technische Zusammenarbeit und Finanzmittel bereitzustellen, um venezolanische Migranten in den Aufnahmeländern zu unterstützen“. Die Region brauche diese Hilfe, um dieses Problem bewältigen zu können. An dieser Stelle hätte der Appell, Fluchtursachen zu beseitigen, vielleicht besser gepasst, denn hier ist die Fluchtursache eindeutig. Ein Regimewechsel in Venezuela würde die Fluchtwelle sicher deutlich bremsen. Laut OAS-Berechnungen würden es täglich knapp 5000 mehr. Allein das Nachbarland Kolumbien habe 1,3 Millionen Venezolaner aufgenommen.
Die Schiffe einer deutschen und einer spanischen Hilfsorganisation sind im Mittelmeer in Richtung Libyen unterwegs, meldet die Presse. Dabei handele es sich um die spanische „Open Arms“ und um die „Alan Kurdi“ der deutschen Organisation „Sea Eye“, habe der italienische Innenminister Matteo Salvini am Samstag auf Facebook erklärt.
Der Innenminister habe den Schiffsbetreibern mit einer hohen Geldstrafe, der Konfiszierung der Schiffe und der Festnahme der Crew gedroht, sollten sie unerlaubt italienische Gewässer erreichen. „Die strenge Linie der italienischen Regierung trägt dazu bei, die EU zu wecken. Wir wollen Migrantenabfahrten, Dramen und Tote im Mittelmeer verhindern“, habe Salvini gesagt.
Gerade einmal 20 Migranten seien nach ihrer Festsetzung an der österreichisch-deutschen Grenze in ein anderes EU-Land zurückgeschickt worden, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage der „Welt am Sonntag“ mit, meldet dernewsticker. Demnach wären seit August 2018 nur 18 Personen nach Griechenland gebracht worden und zwei nach Spanien. Das spanische Innenministerium habe auf Anfrage erklärt, man hätte zur Anzahl zurückgenommener Migranten gar keine Informationen.
Die griechischen Amtskollegen hätten eine Stellungnahme abgelehnt. Im Juni vergangenen Jahres war zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ein Streit um die Zurückweisung von Migranten entbrannt, in dem Seehofer gefordert habe, dass Deutschland deutlich mehr Asylbewerber zurückweisen solle als zuvor, vor allem die, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt hätten.
Jährlich wären das laut Schätzungen bis zu 40.000 Migranten gewesen, berichte die „Welt am Sonntag“. Merkel sei dagegen gewesen und habe sich mit ihrem Versprechen durchgesetzt, „wirkungsgleiche“ Verabredungen mit europäischen Partnern zu treffen. Diese Staaten würden Migranten zurücknehmen, die bei ihnen bereits einen Antrag gestellt hätten und in der europäische Fingerabdruck-Datenbank Eurodac auftauchten.
Allerdings hätten schließlich nur Griechenland und Spanien ein Abkommen mit der Bundesregierung unterschrieben. Ein weiteres Problem: Die Vereinbarungen würden nur bei Asylbewerbern greifen, die bei Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt werden.
Pflegekräftemangel, überbordende Bürokratie, permanente Unterfinanzierung sowie das Überangebot an Kliniken bedrohen in den nächsten fünf Jahren die Existenz zahlreicher Krankenhäuser in Deutschland, meldet dernewsticker. Das gehe aus einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung KPMG zur Situation der Krankenhäuser in Süddeutschland hervor, über die die „Welt am Sonntag“ berichtet habe. Grundlage für den Befund sei die Befragung der Geschäftsleitungen von Kliniken in Baden-Württemberg und Bayern. Demnach hätten 2018 sechs von zehn Krankenhäusern in Baden-Württemberg und Bayern Verluste verzeichnet.
Bei öffentlichen Kliniken seien es 78 Prozent gewesen, während die privat geführten Mitbewerber zu 25 Prozent in den roten Zahlen steckten. Zwei von drei der befragten Kliniken in Baden-Württemberg sähen das wirtschaftliche Überleben ihres Krankenhauses durch die Unterfinanzierung der Notfallversorgung demnach bedroht. Dass ihr Haus gegen den Fachkräftemangel Medizin und Pflege gewappnet wäre, hätten der Umfrage zufolge 53 Prozent der Klinikverantwortlichen in Baden-Württemberg und 82 Prozent in Bayern verneint. Drei Viertel der Krankenhäuser in beiden Bundesländern sähen eine Anwerbung von ausländischen Fachkräften für den Weiterbetrieb als „unbedingt notwendig“ an. Meist müssten zunächst deutsche Sprachkenntnisse vermittelt werden, was oft Jahre dauere. „Gerade bei der Pflege von Menschen ist die Kommunikation ganz wichtig“, habe Philipp Ostwald, der Geschäftsführer des Klinikums Landshut, der „Welt am Sonntag“ gesagt. Sein Resümee ist ganz klar: „Das gesamte Krankenhaussystem wird an die Wand gefahren. Wir müssen unbedingt die Notbremse ziehen“.
Der Bundeswehr fehlen laut eines Zeitungsberichts in den Jahren 2020 bis 2023 Haushaltsmittel in Höhe von rund 33 Milliarden Euro, meldet dernewsticker. Das berichte die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf die vertrauliche „Finanzbedarfsanalyse 2020“ des Verteidigungsministeriums. Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett bekanntlich den Gesetzentwurf für den Bundeshaushalt 2020 samt Finanzplanung bis 2023 beschlossen. Danach enthalte die Bundeswehr 2020 44,9 Milliarden Euro. In den Jahren von 2021 bis 2023 sehe die Regierung allerdings einen von 44,1 auf 43,9 Milliarden Euro wieder leicht fallenden Wehretat vor. Der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gehe damit zurück, von 1,37 Prozent in 2020 auf 1,24 Prozent im Jahr 2023.
In der Finanzbedarfsanalyse aus der Planungsabteilung des Wehrressorts würden die Mittel berechnet, die „zur Erreichung multinationaler Vorgaben und nationaler Ambition“ notwendig seien. Der Vergleich der von der Bundeswehr als notwendig erachteten Mittel mit dem Bundeshaushalt ergebe für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag von rund sechs Milliarden Euro. Dieser steige in den folgenden Jahren.
Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa legen CDU/CSU um zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche auf 26 Prozent zu und liegen jetzt gleich auf mit den Grünen an der Spitze, meldet focus.de. Grüne und AfD würden demnach je einen Prozentpunkt verlieren.
Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 26 Prozent, Grüne 26 Prozent, SPD 12 Prozent, AfD 12 Prozent, FDP 8 Prozent, Linke 8 Prozent und 8 Prozent für die sonstigen Parteien. 19 Prozent aller Wahlberechtigten seien derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erwägt eine Kandidatur für den Bundesvorsitz seiner Partei, meldet das Berliner Sonntagsblatt. Zwar sei dieses Amt „keine Aufgabe, für die man sich mal eben so meldet“, wenn es aber bei Kevin Kühnert und Gesine Schwan als einzige Kandidaten bleibe, „würde ich mir überlegen, auch anzutreten“, habe Pistorius der „Welt am Sonntag“ gesagt. Für den Fall seiner Bewerbung kündigte der niedersächsische Innenminister an, nur „im Tandem“ antreten zu wollen. Zwar sei er ursprünglich gegen den Vorschlag der drei amtierenden Parteichefs gewesen, eine Doppelspitze im Willy-Brandt-Haus zu installieren, inzwischen trage er die entsprechende Entscheidung des Parteivorstands aber „voll mit“, wie es weiter heißt. Allein Verantwortung zu übernehmen ist heutzutage ja auch nicht en vogue.
Mehrere Parteienrechtler haben das Verfahren kritisiert, mit dem die SPD eine neue Parteispitze sucht, meldet die FAZ. Der Versuch, über eine Mitgliederbefragung eine Doppelspitze durchzusetzen, widerspreche dem Organisationsstatut der Partei, habe der Staats- und Verwaltungsrechtler Jörn Ipsen der «Welt am Sonntag» gesagt. Das Verfahren sei unzulässig. Tatsächlich ist eine Doppelspitze in der SPD-Satzung nicht vorgesehen – diese Möglichkeit solle erst nach der Mitgliederbefragung auf einem Parteitag geschaffen werden.
Die schleswig-holsteinische AfD hat die von einem Parteiausschluss bedrohte Doris von Sayn-Wittgenstein erneut zur Landesvorsitzenden gewählt, meldet die Welt. Die 64-jährige Landtagsabgeordnete, gegen die der AfD-Bundesvorstand im Dezember ein Parteiausschlussverfahren wegen der Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein eingeleitet habe, hätte sich am Samstag in einer Kampfabstimmung beim Parteitag in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt.
Sayn-Wittgenstein habe 137 von 244 abgegebenen Stimmen und damit 56 Prozent erhalten. Ihr schärfster Konkurrent Christian Waldheim, AfD-Fraktionschef in Norderstedt und AfD-Bundesrechnungsprüfer, sei mit 100 Stimmen unterlegen. Er gelte als Verfechter der Linie des AfD-Bundesvorstandes.
Sayn-Wittgenstein war hingegen aus der schleswig-holsteinischen AfD-Landtagsfraktion unter dem Fraktionschef Jörg Nobis ausgeschlossen worden, wogegen von Sayn-Wittgenstein Klage beim Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein eingereicht habe. Darüber sei noch nicht entscheiden. Am 19. Dezember 2018 sei von Sayn-Wittgenstein als Landesvorsitzende zurückgetreten, nachdem der AfD-Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren gegen sie eingeleitet hatte. Dieser Antrag sei aber vom AfD-Landesschiedsgericht in Schleswig-Holstein abgelehnt worden. Der Bundesvorstand hätte daraufhin Widerspruch beim AfD-Bundesschiedsgericht eingelegt, das bisher aber noch nicht entschieden habe.
Ein hochrangiges Mitglied des russischen Militärgeheimdienstes GRU soll den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal im südenglischen Salisbury koordiniert haben, meldet die Zeit. Das gehe aus einem Bericht des Recherchenetzwerks Bellingcat in Zusammenarbeit mit der BBC hervor. Der GRU-Mann habe sich demnach zum Zeitpunkt des Anschlags in London befunden und mittels verschiedener Messengerdienste mit den ausführenden Agenten kommuniziert.