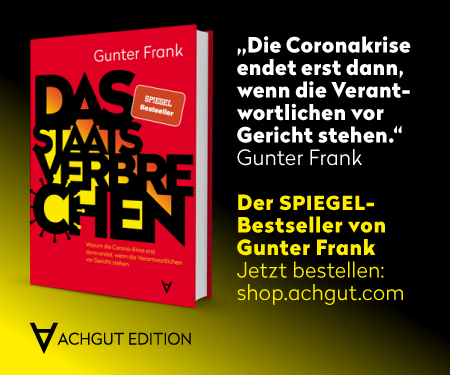Die Entfernung von Jerusalem, wo er aufgewachsen war, studiert hatte, und wohin er auch heute noch durchschnittlich einmal wöchentlich fährt, hatte er falsch eingeschätzt, deshalb verlassen wir die Tel Aviver Autobahn erst bei Ramla und versuchen dann vergeblich, seinen weiteren telefonisch durchgegebenen Wegbeschreibungen zu folgen. Verlegen uns schließlich aufs Fragen am Straßenrand: Hulda? Nie gehört. Hulda? Tja, da seid ihr hier ganz falsch…
Wir sind zu viert: der New Yorker Multimediameister Richard Kostelanetz und seine Freundin Aviva Ebstein, die amerikanische Schriftstellerin Rita Dove und ihr Ehemann – nämlich ich. Den Kibbuz Hulda, 1908 gegründet und jahrzehntelang, umgeben von arabischem Territorium, gefährdeter linkszionistischer Außenposten, erreichen wir schließlich mit über einer Stunde Verspätung und sind froh, dass uns unser Gastgeber dort erstmal aus der Vormittagshitze in sein ventilatorerfrischtes kleines Arbeitszimmer führt. Da sitzen wir erschöpft in einer der für Kibbuzarchitektur oft so charakteristischen getünchten Minibehausungen zwischen vom Fußboden bis zur Decke mit Büchern bedeckten Wänden und staunen, wie frisch dieser Gastgeber, der Autor Amos Oz, seit Morgengrauen auf den Beinen und am Schreibtisch, noch die Unterhaltung zu führen vermag.
Amos Oz, einer der bedeutendsten Schriftsteller Israels, ist ein Sabra. Er wurde am 4. Mai 1939 als Sohn Yehuda Arieh Klausners, des Rechtszionisten und Mitherausgebers der Encyclopedia Hebraica, in Jerusalem geboren. Früh löste er sich vom konservativen Elternhaus und kam 1955 nach Hulda, das damals unmittelbar an der Green Line zu Jordanien lag. “Ich wurde Sozialist, weil meine Eltern Rechte waren, und wurde Kibbuznik, weil meine Eltern in der Stadt wohnten, und wahrscheinlich wurde ich Romancier, weil mein Vater ein Gelehrter war.”
Stolz zeigt er uns “seinen” Kibbuz. Die ersten Schritte führen zu einem Kinderhaus, wo sein knapp zweijähriger Sohn Daniel Arieh Oz (benannt nach dem Vater und einem von den Nazis ermordeten Vetter) ihm von den Armen einer Volontärin entgegenlacht. Die Kinder auf Hulda bleiben nur am Nachmittag, nach der Arbeit, bei ihren Eltern, sie kehren des Nachts zurück in die nach Altersgruppen aufgeteilten bunten Kinderhäuser, die von einer Nachtschwester über ein Intercom-System kontrolliert werden. Dieses Intercom-System wurde 1965 mit dem Geld angeschafft, das Oz‘ erster Literaturpreis einbrachte.
Ein Sohn und zwei Töchter
Im Kinderhaus für die Erstklässler begrüßt uns freudiges Gebrüll. Amos schuldet ihnen eine Geschichte; “eine meiner Sabbatpflichten ist, den Kindern Geschichten zu erzählen, und das letzte Mal hab ich eine angefangen und noch nicht zu Ende erzählt.”
Außer dem kleinen Sohn haben Amos Oz und seine Frau Nily zwei Töchter, fünfzehn und achtzehn Jahre alt. Fania, die Achtzehnjährige, treffen wir in ihrem Zimmer an, das sie mit einer Gleichaltrigen im Jugendkomplex teilt. Ihr Vater bekennt, er habe Angst davor, daß sie bald zur Armee muß. Sie sei besonders sensibel, obwohl: “Niemand ist dafür geboren, die Disziplin, die Reglementierung, den Gehorsam.” Er selbst kämpfte 67 im Sinai und 73 auf den Golanhöhen, aber schreiben darüber kann und mag er nicht: “Es ist unmöglich. Diejenigen, die auf den Schlachtfeldern waren, wissen, wie es ist, und jene, die nicht da waren, wissen es nicht. Beschreibe einem Mönch, wie es ist, wenn Mann und Frau miteinander schlafen. Krieg ist Gerüche und Gestank –brennender Gummi, Pulver, brennendes Metall. Nichts kann das in Worte fassen.”
Neben Obst- und Baumwollfeldern, Kichererbsenverarbeitung und einer Transformatorenfabrik (der “Goldmine” seit einigen Jahren, obgleich sie den tolstoischen Idealen der Gründer widerspricht) beherbergt Hulda auch das zentrale Archiv der sozialistischen Kibbuzbewegung. Dort arbeitet Nily Oz, und nebenbei hat sie dort auch das private Archiv ihres Mannes eingerichtet. Es dokumentiert die einzigartige Geschichte eines Autors, der wie kein anderer für die progressiven Ideale der zionistischen Vergangenheit in ihrer Projektion auf die Zukunft steht, eine Geschichte, die seit fünfundzwanzig Jahren auch Kibbuzgeschichte macht.
Bevor Amos Oz 1957 zur Armee eingezogen wurde und auf Wehrsiedlungen im Nahal seinen Dienst tat, arbeitete er auf dem Feld und schloss die Oberschule ab. In seiner Freizeit verfasste er patriotische Verse und Detektivgeschichten. 1960 erschienen seine ersten Gedichte und eine Erzählung, 1961 heiratete er Nily, eine “Eingeborene” von Hulda. Dann sandte ihn der Kibbuz auf die Hebrew University, allerdings nur für zwei Jahre. “Sie wollten nicht, dass ich einen Abschluß machte. Sie glaubten wahrscheinlich, ich würde dann davonlaufen. Ich narrte sie aber doppelt, indem ich den Abschluss in zwei Jahren schaffte – in Philosophie und hebräischer Literatur – und doch zurück kam.”
Philosophie für die Kibbuz-Kinder
Seit 1963 lehrt Oz Literatur und Philosophie an der für mehrere umliegende Kibbuzim zuständigen Oberschule; zunächst waren es sechs Tage die Woche, doch dann, je mehr er sich als Schriftsteller durchsetzte, wurde diese seine “Pflicht” reduziert bis auf heute zwei Wochentage. 1965 erschien sein erstes Buch, “Wo der Schakal heult”, eine Sammlung von Kurzgeschichten, die mit dem renommierten Holon-Preis ausgezeichnet wurde und dadurch den Kindern von Hula das Intercom bescherte, und im Jahr darauf der erste Roman, der ihm kontroverse Berühmtheit einbrachte: “Sonstwo vielleicht”, ein Porträt des Lebens auf dem fiktiven, paradigmatischen Kibbuz Metsudat Ram, kritisch und formal ungewöhnlich.
So gehört die Erzählstimme dem Kibbuz selbst (“Wir”), eine – sagt Oz – vom Chor der griechischen Tragödie gelernte Technik, und manchmal spricht auch jede der sieben Hauptpersonen für sich selbst. Natürlich setzte das Buch in Hulda harte Diskussionen in Gang, die Kommentare reichten von “Wie kannst du es wagen” bis “Endlich sagt mal jemand die Wahrheit”. Und wie sehr ist das Buch ein Schlüsselroman? Amos Oz: “Ich benutze nie lebende Modelle. Wenn ich das täte, wäre es schwer für mich, hierzubleiben. Es ist mehr Photosynthese als Photographie.” Und er fügt lachend hinzu: “Außerdem haben die Leute eine so hohe Meinung von sich selbst, dass sie wahrscheinlich, wenn man sie so porträtierte, wie sie sind, sich selbst gar nicht erkennen würden.”
Empfindet er sich nicht als Ausnahme, wird er nicht als Ausnahme empfunden und behandelt? Wie verhalten sich die Mitkibbuzniks einem gegenüber, der so aus der Rolle fällt, der nicht in den Feldern sät und erntet, sondern ganz allein, aber mitten unter ihnen, in seinem Raum sitzt und womöglich das beschreibt, was die anderen tun? “Ich war immer ein guter Kellner im Esssaal, und das ist’s, was hier zählt. So kennen mich die meisten. Wenn ich dran bin, gehe ich selbstverständlich auch auf Nachtpatrouille. Mit einer Maschinenpistole in der Hand kontrollierst du die Felder und fühlst dich wie’n Held, von elf Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Und zwischen meinen literarischen Projekten geh ich raus und arbeite auf den Feldern, pflücke Äpfel oder fahre einen Traktor.” Aber ist da nicht auch eine Wechselbeziehung zwischen dem Kibbuz und den literarischen Produkten des Kibbuzniks Amos Oz? “Ich bin umgeben von Menschen, die ich gut kenne, die mich gut kennen, die mit ihrer Meinung über mein Schreiben nicht hinter’m Berg halten. Es ist nützlich, in so einem direkten und offenen Milieu zu leben.”
Für Oz ist der Kibbuz die ideale Großfamilie. “Würde ich in New York leben, hätte ich nicht so eine intime Bekanntschaft mit dreihundert verschiedenen Menschen. Ich bin nicht William Faulkner, aber alles das, was er im tiefen Süden der USA fand, das kann ich hier finden.”
Hierarchie, Priorität, Interaktion
Was findet Amos Oz in Hulda, seiner Heimat? Ja, Geschichten, Menschen, Charaktere, gewiss. Auch sich selbst? Versucht er sich selbst literarisch zu finden und damit vielleicht eine Antwort auf seine Zweifel und seine Hoffnungen? Es sei merkwürdig, sagt er: “Die meisten meiner Charaktere glauben an etwas, das ich nicht glaube. Sie glauben an eine einfache Lösungsformel, sei es ein ‚Anderswo‘ oder ‚Gewalt‘ oder sei es ‚Liebe‘ – was immer einige von ihnen unter dem Wort verstehen mögen.” Er schreibe seine Romane aus Lust an umfassender Organisation – “Hierarchie, Priorität, Interaktion”. Organisation sei eine religiöse Erfahrung. Wenn es ihm nicht gelänge, eine Geschichte oder einen Roman zu schreiben über ein Thema oder wenn es ihm um eine direkte, nicht ambivalente Botschaft ginge, dann schriebe er halt einen Essay. “Um es einfach auszudrücken: Wenn ich völlig mit mir selbst übereinstimme, dann schreibe ich einen Artikel.”
1969 erschien “Mein Michael” und wurde ein sensationeller internationaler Bestsellererfolg, den der Autor selbst bis heute nicht versteht: “Das Buch hat keine Gewalt, keinen Sex, nichts. Es muß irgendwo einen Nerv getroffen haben.” Es ist die Geschichte der jungen Hausfrau Hannah Gonen, ihrer Träume und Desillusionierungen im Leben mit ihrem Mann Michael, ihrer Depressionen und schließlich ihres Zusammenbruchs in einer kleinbürgerlichen Jerusalemer Atmosphäre der fünfziger Jahre – “am Morgen danach” für Israel, sagt Oz.
Von den Einkünften dieses Buches hätte der Autor leicht in den Luxus außerhalb des Kibbuz abspringen können – ein für ihn undenkbarer Vorgang, und würde er Abermillionen umsetzen. Der Kibbuz ist seine Lebensgrundlage. “Bei jedem Schekel, den ich einbringe, signiere ich einfach den Scheck gegen und gebe ihn dem Schatzmeister. Um Einnahmen und Ausgaben brauche ich mich nicht zu kümmern. Alles, was ich für meine Arbeit benötige, auch Reisen, erhalte ich, und das nicht erst, seit ich berühmt bin und meine Bücher sich gut verkaufen. Ich war nie auf Verlagsvorschüsse angewiesen und musste nie Abgabetermine einhalten.”
Amos Oz spricht mit dem Selbstbewusstsein dessen, der einen festen Halt hat und sich darauf unbedingt verlassen kann. Was soll private Besitzanhäufung, wenn der momentane Bedarf in jeder Hinsicht gedeckt wird und die Zukunft einschließlich etwaiger Erfolgslosigkeit und eines unproduktiven Alters in der Sozialgemeinschaft des Kibbuz gesichert ist? Natürlich ist Hulda auch stolz auf ihn, und es kam schon zu kuriosen Begebenheiten. So bot der Direktor der Arbeitsrotation seinem so überdurchschnittlich Geld einbringenden Freund Amos einmal zwei ältere Assistenten an, im Glauben, das könnte die Produktivität des Bücherschreibens noch steigern.
Aus dem Heiligen Land an das Holy Cross College
1969 wurde er vom Holy Cross College (ausgerechnet!) in Oxford für ein Jahr als writer-in-residence eingeladen, und erstmals in seinem Leben verließ er Israel. Seine Frau und die beiden Töchter begleiteten ihn. “Es war meine erste Berührung mit europäischem Wetter, einer fremden Sprache, gotischer Architektur und einer organisierten Zeitabfolge.” Er lernte Englisch so perfekt, dass er sich zehn Jahre später nicht nur fließend mit uns unterhalten kann, sondern auch komplizierte Zusammenhänge mit faszinierender Genauigkeit zu erläutern vermag.
In Oxford schrieb er zwei Novellen: “Kreuzzug” und “Letzte Liebe”, die er 1971 unter dem Titel “Bis zum Tod” als Buch veröffentlichte. Zwei Jahre später, kurz vor dem Yom Kippur-Krieg, kam sein dritter Roman heraus: “Berühr das Wasser, berühr den Wind”. Das Buch entstand aus Material, das er seit langem für eine Familiensaga gesammelt hatte, und handelt von David Klausner, dem Bruder seines Vaters.
Als Yehuda Klausner nach Palästina auswanderte, zog sein Bruder es vor, in Wilna zu bleiben, wo er an der Universität vergleichende Literaturwissenschaft lehrte. Zu einer Zeit, als viele entweder Kommunisten oder Nationalisten waren, war er ein überzeugter Europäer. “Onkel David weigerte sich, sich dem Zionismus oder irgendeinem anderen Chauvinismus zu ergeben. Und als die Nazis kamen, bezahlten er, seine Frau und sein Sohn, mein Vetter Daniel, das mit ihrem Leben. Meine ganze Kindheit hindurch hörte ich jedoch Gemunkel, Onkel David sei doch sicher zu klug gewesen, so zu sterben; eines Tages würde er auftauchen…”
1976 erschien “Ein Hügel des Bösen Rats”, drei Novellen über Jerusalem in den Mitt-Vierzigern. Auf dem “Hill of Evil Counsel” residierte damals der britische Hochkommissar. (Heute dient er als U.N.-Hauptquartier.) “Das Jerusalem meiner Kindheit war ein Irrenhaus. Es gab dort mehr Verrückte als irgendwo sonst auf der Welt. Jeder war ein Messias. Jeder war ein Erlöser. Jeder hatte eine Formel für eine universelle schnelle Lösung parat. Viele der Pioniere erklärten, sie kämen nach Israel, um es aufzubauen und dabei selbst regeneriert zu werden. Heimlich sehnten sie sich nach Kreuzigung, danach, zu kreuzigen und gekreuzigt zu werden. Sie glaubten, die Welt benötige dringend Erlösung – Erlösung in Gewalt, Schmerz und Blut. Sie alle folgten demselben Drang: Reinige und werde gereinigt. Entweder töte die Schlechten, um den Guten zu helfen, oder stürze dich selbst in den Tod, um einen Schock auszulösen, der die Welt verändert.”
Von diesen An- und Widersprüchen handeln die drei Novellen. Seit er sie abschloss, veröffentlichte er noch eine Erzählung für Jugendliche, “Sumchi”, und eine Sammlung von Essays über Literatur, Politik, Kibbuzzim und Sozialismus. Jetzt arbeitet er an einem umfangreichen Roman, der den Bogen spannen soll von der ostjüdischen Geschichte seiner Vorfahren bis zu den Problemen, die heute Israel zu schaffen machen.
Literatur made in Israel
Obwohl er nicht in einer der Metropolen lebt, nimmt er rege teil am israelischen Literaturbetrieb, und als er darüber spricht, schwingt Begeisterung mit: “Israel hat vielleicht die faszinierendste, wenn auch nicht die beste literarische Szene in der heutigen Welt, einfach wegen des ungeheuren Entwicklungsdrucks. Wir haben Symbolisten und Realisten, Surrealisten und Dadaisten. Es gibt mehr als hundert israelische Schriftsteller mit einer ungeheuren Vielfalt an Stilen, Tendenzen, Literaturkonzepten, Schreibeigenarten. Es gibt nicht mal einen vagen Konsens, was und wofür Literatur eigentlich sein soll. Wenn man im richtigen Tel Aviver Café zur richtigen Zeit sitzt, kriegt man zum Beispiel den John Dunne, den Allen Ginsberg und den Byron der hebräischen Dichtung alle auf einmal und voll in Fahrt mit – und zwar nicht im ruhigen Gespräch miteinander, sondern in lautstarker Auseinandersetzung.”
Auch Amos Oz hat, wenn’s drauf ankommt, eine laute Stimme. Er erhebt sie zugunsten von Peace Now und gegen die Begin-Regierung; bei den Reaktionären hat er den Ruf eines ultralinken Revolutionärs. Dabei versteht er sich selbst als gemäßigt.
“Ich bin eher ein Evolutionär als ein Revolutionär, in allem – im Geschichtenerzählen, in Fragen des Sozialismus, im Sex. Obwohl man mich gerne als Radikalen hinstellt in der israelischen Politik, glaube ich, nie in irgendwas wirklich radikal gewesen zu sein. Bezüglich des israelisch-arabischen Konflikts habe ich immer an einen inkonsequenten Kompromiss geglaubt. Beide Seiten haben ihre durchaus soliden Gründe. Der israelisch-palästinensische Konflikt – nicht der israelisch-arabische, das ist etwas anderes – ist kein Wildwestfilm, sondern eine Tragödie. Helden von Tragödien, besessen von ihrem Gerechtigkeitswahn, zerstören und vernichten einander. So sterben Menschen, und die ‚Gerechtigkeit‘ siegt. Die einzige Möglichkeit, einen tragischen Konflikt zu überleben, ist ein inkonsequenter Kompromiss. Politisch ausgedrückt: Zwei Völker betrachten dieses Land als ihre eine wahre Heimat. Also ist die einzige Möglichkeit fürs Überleben, es zu teilen. Praktisch ausgedrückt bedeutet das zwei unabhängige Staaten in einem Land, das kaum groß genug ist für einen.
Ich stimme zu, daß es prinzipiell, theoretisch und in der historischen Perspektive keinen Unterschied gibt zwischen West-Jerusalem und Ost-Jerusalem, zwischen Hebron und Haifa, zwischen Nablus und Jaffa. Wir wissen auch, daß der Sinn der Palästinenser für ihre Identität und ihre Einzigartigkeit zum großen Teil ein Nebenprodukt des Zionismus ist, aber das können wir nicht ändern. Palästinenser und Israelis haben beide volle Ansprüche, jeweils in sich selbst legitim und gerecht, auf jeden Zentimeter dieses Landes. Entweder sie teilen es, oder sie werden es vernichten. Ich selbst allerdings konnte Nationalstaaten noch nie etwas abgewinnen. Das Konzept von Zivilisationen, die über ihren Territorien Fahnen flattern lassen, kommt mir archaisch und mörderisch vor. In der Hinsicht haben wir Juden jahrtausendelang vorgeführt, was ich gerne als die nächste Phase der Geschichte sähe: eine Zivilisation ohne territoriale Grenzen, beziehungsweise zweihundert Zivilisationen ohne einen einzigen Nationalstaat. Aber als Jude kann ich mir solche Illusionen nicht mehr leisten. Ich habe zwei Jahrtausende ein Beispiel gegeben, doch niemand folgte.”