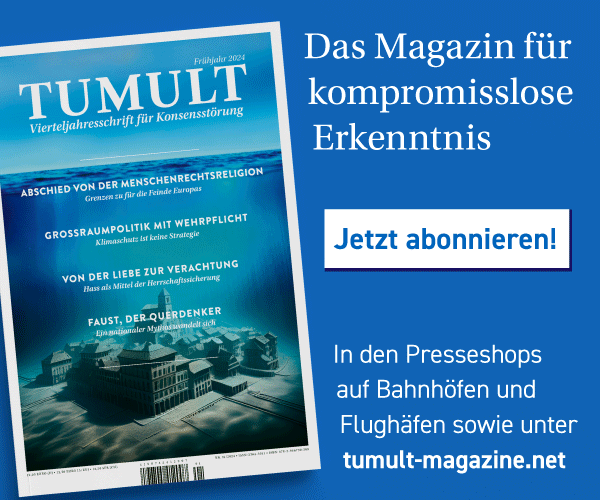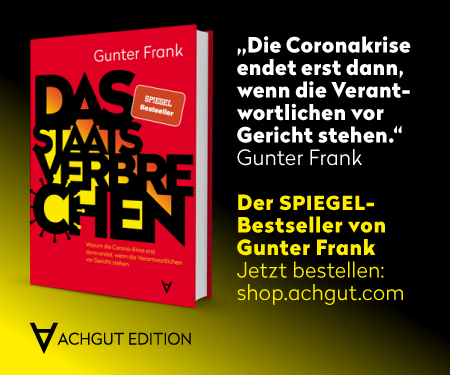Tja, wer sich mit “Klimarettern”, also Klimafanatikern und -Verrückten, ins Bett legt sollte sich nicht wundern, dass die PR-Aktion nach hinten los ging.
Der Mist wurde schon 2013 beschlossen! Und niemand hats gemerkt?
Ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es bedarf weiterer Schritte und auch mal beherzter Tritte - in die Hintern der grün-schwarz-roten Schwachköpfe. Hinweis im gleichen Kontext: überall auf diesem Planeten setzt man auf Nukleartechnik. Innovativ, sauber, effizient. Diese Info blenden die Schwachköpfe - deren Hirne offenbar bleiummantelt sind - aus.
Die künftigen Verbrenner werden allesamt aus China kommen. Dem Land, dem der Westen mit der vermeintlichen Umstellung auf das E-Auto böse auf den Leim gegangen ist. Verbrennertechnologie hat für die Chinesen geostrategische Bedeutung
“Denn eine Empfehlung muss erst mal befolgt werden.” Verzeihung, aber sprachlich ist das Nonsense. Das bedeutet natürlich nicht, dass so etwas nicht im EU-Recht vorkommt. Aber: “Den Mitgliedstaaten ist es freigestellt, ob sie die Empfehlungen umsetzen.” (Sagt die grosse allwissende Müllhalde Wikipedia.) Ihr Votum für Technologieoffenheit ist völlig richtig. Als ich noch in diesem Metier tätig was, bis 2004, war das unstreitig in der Bundesregierung. Dann übernahm die jetzige Truppe mit ihrer technische Ahnungslosig- und politischen Übergriffigkeit. Möglichst viel und kleinteilig regeln, dass ist der Traum der Staatsplanungsfanatiker.
Machen wir uns nichts vor. Die seriösesten Argumente werden nicht fruchten, wenn ab Herbst Grün/Schwarz das Land beherrschen wird. Dass die Umwelt nicht an Deutschlands Grenzen endet, ist den selbsternannten Weltverbesserern völlig schnuppe. Hauptsache, das eigene Ego wird hinreichend gestützt. Man/frau/es ist gut, so gut, die Besten auf der Welt - wieder einmal.
Ich stimme Ihren Ausführungen zu 100 % zu. Leider geht es bei unseren Politikern aber nicht um Fakten und gesunden Menschenverstand, sondern um Ideologie. Die Indoktrination unsrer Gesellschaft mit diesem Gedankengut schreitet immer weiter voran. Ist es schon mal aufgefallen, dass kritische Stimmen im öffentlich-rechtlichen TV (z.B. Prof. Sinn) gar nicht mehr zu hören sind?
„Denn nicht der Motor ist ein Problem für das Klima, sondern der fossile Kraftstoff.” Hirnverbranntes Gefasel. Aber was erwartet man von der Tante? BDEW, RWE, stramm auf E-Mobilitätslinie - von einem „geschickten Statement” sehe ich in dem ganzen Artikel nichts. Nur das übliche, wachsweiche, gummiartige Rumgeseiere. Passt zu ihr.
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.