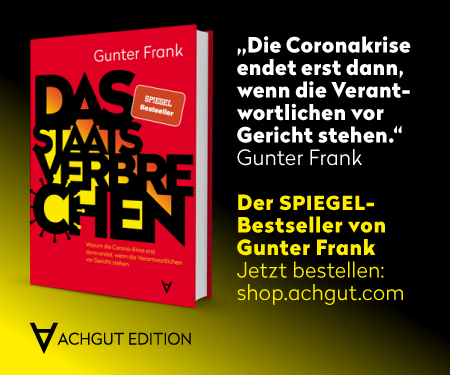Die Entwicklung historischer Ereignisse scheint im Rückblick vielfach zwangsläufiger, als sie es tatsächlich gewesen ist. Das gilt auch für das komplizierte Verhältnis der USA zu Russland. Dass sich die Beziehungen Washingtons und Moskaus auch ganz anders hätten entwickeln können, zeigen bisher unveröffentlichte Archivdokumente. Ein Innehalten zum bevorstehenden Jubiläum des Ukraine-Krieges.
Am 7. Februar 2023 hat das nationale Sicherheitsarchiv der George-Washington-Universität drei geheime Dokumente aus dem Jahr 1993 veröffentlicht. Die geborgenen Unterlagen sind brisant. Unter ihnen befinden sich eine Abschrift des ersten Gesprächs von Bill Clinton mit Boris Jelzin sowie eine Nachricht des scheidenden Außenministers Lawrence Eagleburger an seinen Nachfolger Warren Christopher. Darin warnt Eagleburger eindringlich vor der Gefahr eines bewaffneten Konflikts im postsowjetischen Raum.
Der 23. Januar 2023 ist ein geschichtsträchtiges Datum und doch kaum als solches bekannt. An diesem Tag fand das erste Telefongespräch zwischen Boris Jelzin und Bill Clinton als Präsident der Vereinigten Staaten statt. Drei Tage zuvor hatte Clinton im Oval Office des Weißen Hauses Platz genommen. Als sich die beiden Männer im Juni 1992 erstmals persönlich getroffen hatten, war Clinton noch der 42. Gouverneur von Arkansas gewesen. Als Spitzenkandidat der demokratischen Partei hatte er sich bereits für die bevorstehenden Wahlen in Stellung gebracht. Jelzin wiederum befand sich damals auf einem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten.
Es ist nicht möglich, die Eindrücke zu reproduzieren, die Boris Jelzin in jenen Tagen von den USA gewann. Klar ist jedoch, dass er die Überlegenheit der amerikanischen Volkswirtschaft hautnah erlebte. Während Washington 1992 ein Bruttoinlandsprodukt von 6,52 Billionen Dollar erwirtschaftet hatte, betrug das russische lediglich 435,1 Milliarden Dollar. Die einstige Rivalität mit der UdSSR gab es längst nicht mehr. Was übrig blieb, war ein dysfunktionaler, aus der sowjetischen Erbmasse hervorgegangener Staat, der unter der Last seines Erbens zu kollabieren drohte. Dass diese Situation mit Blick auf das russische Atompotenzial überaus gefährlich war, verstand man in Washington sehr wohl.
Nicht zufällig also begann Clinton das Gespräch mit Jelzin, indem er sofort eine Zusicherung machte: Die Beziehungen zu Russland würden während seiner Präsidentschaft höchste Priorität in der amerikanischen Außenpolitik haben. Hierzu erklärte Clinton: „Wir beabsichtigen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Russland bei der Durchführung demokratischer Reformen zu helfen. Wir werden versuchen, unsere wirtschaftliche Unterstützung so nützlich wie möglich zu gestalten.“ Ferner sagte Clinton zu, sich für Moskau bei der Stundung russischer Schulden gegenüber dem Pariser Club zu verwenden.
Das Zauberwort für den russischen Präsidenten
Der US-Präsident wies auch auf die Bedeutung der Einbeziehung Russlands in internationalen Fragen wie der Situation in Bosnien und dem Irak hin. Jelzin wiederum bekräftigte ebenfalls seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, ohne dabei jedoch die Interessen Moskaus außer Acht zu lassen. Dabei betonte er, dass Russland auf eine politische Lösung der jugoslawischen Frage unter Einbeziehung der UNO und nicht auf eine militärische Intervention der NATO setze.
Auch für Jelzin mussten in jenen Tagen vitale Beziehungen zu den USA höchste Priorität haben. So gab er Clinton klar zu verstehen, dass er ein gemeinsames Treffen spätestens im Februar abhalten wolle. Diese Absicht drückte Jelzin mit folgenden Worten aus: „Ich denke, die ganze Welt wartet auf dieses Treffen, denn der neue amerikanische Präsident könnte die Politik [gegenüber Russland] ändern und gleichzeitig die allgemeine Richtung unserer Politik und mich persönlich unterstützen.“
Man kann feststellen, dass auch Clinton diese Einschätzung teilte. Zwar entgegnete er Jelzin, sich zunächst auf innenpolitische Angelegenheiten konzentrieren zu müssen. Dies gelte insbesondere für seine jährliche Rede vor dem Kongress. Danach sei er jedoch bereit, unverzüglich Jelzins Wunsch zu entsprechen. Die Präsidenten einigten sich darauf, dass das geplante Gipfeltreffen auf dem Territorium eines Drittlandes stattfinden sollte. Die Wahl des Standortes überlies Jelzin Bill Clinton. Zwei Monate später sollten die beiden Staatschefs schließlich im März 1993 in Vancouver aufeinandertreffen.
Am Ende des Telefonats äußerte Clinton einen Gedanken, der aus heutiger Sicht geradezu surreal erscheint: „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die engst mögliche Partnerschaft zwischen Russland und den Vereinigten Staaten erreichen können.“ Wie das Sicherheitsarchiv in einem Kommentar zum Protokoll feststellt, sei dies exakt gewesen, was Jelzin aus dem Mund eines amerikanischen Präsidenten habe vernehmen wollen. Treffend stellen die Kommentatoren fest: „Das Wort 'Partnerschaft' war wie ein Zauberwort für einen russischen Präsidenten, der sich um eine Annäherung an die vorherige Regierung im Weißen Haus bemüht hatte, sie aber von Bush nicht hatte bekommen können."
Die ersten gemeinsamen Kontakte bilanzierend, lässt sich sagen, dass sowohl Clinton als auch Jelzin darin miteinander übereinstimmten, das Verhältnis ihrer Länder künftig auf eine neue Grundlage zu stellen. War die Sichtweise Russlands in der Regierung George Bushs noch stark von der Zeit des Kalten Krieges geprägt, als die Sowjetunion gleichsam als „Reich des Bösen“ figurierte, hatte sich dies nun geändert. Mit Bill Clinton war ein junger und dynamischer Präsident ins Weiße Haus eingezogen, sämtlicher Altlasten seiner Vorgänger ledig.
„Historische Chance“
Boris Jelzin wiederum hatte als Präsident der russischen Sowjetrepublik (russ.: RSFSR) dafür gesorgt, dass die UdSSR letztlich beerdigt werden konnte. 1990 hatte er die Völker der RSFSR öffentlich dazu ermutigt, so viel Souveränität zu nehmen, wie sie tragen könnten. Noch bedeutender jedoch war die Niederschlagung der August-Putschisten von 1991. Damals hatten strukturkonservative Kader der KPdSU das Weiße Haus in Moskau besetzt. Ihr Ziel war es, die von Gorbatschow initiierten Wirtschaftsreformen durch einen Staatsstreich zu verhindern. Dass dieser Versuch nach drei Tagen scheiterte und die Sowjetunion zum Jahresende aufgelöst wurde, war zu einem erheblichen Teil das Verdienst Jelzins.
Ein weiteres Dokument, das am 7. Februar 2023 vom Nationalarchiv veröffentlicht wurde, ist eine Botschaft des scheidenden Außenministers Lawrence Eagleburger an seinen Nachfolger Warren Christopher vom 5. Januar 1993. In einem Schreiben umreißt Eagleburger die Hauptstoßrichtungen der amerikanischen Außenpolitik und geht auf mögliche Bedrohungen ein.
Hierzu konstatiert er: „Wir befinden uns in einer Welt, die sich inmitten eines revolutionären Wandels befindet, in der Sie sowohl mit einer historischen Chance zur Gestaltung einer neuen internationalen Ordnung als auch mit ernüchternden Herausforderungen konfrontiert sind.“ Ferner befänden sich die USA zum ersten Mal seit 50 Jahren in einer Situation, in welcher sie nicht mit einem globalen bewaffneten Gegner konfrontiert seien.“
Nebst diesem Befund kommt Eagleburger sodann auf die sich daraus für Washington ergebenen Chancen zu sprechen. In diesem Zusammenhang führt er aus: „Die allmähliche Eingliederung eines sich reformierenden Russlands und der Osteuropäer in ein stabiles europäisches System ist eine Chance".
Andererseits skizziert er aber auch mögliche Probleme. Dazu gehört für ihn vor allem ein bewaffneter Konflikt zwischen Russland und einem der Staaten an seiner Peripherie. Dieses Szenario sei zwar nicht das wahrscheinlichste, wohl aber das gefährlichste. Darüber hinaus bringt Eagleburger seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan könnten womöglich ihre Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung nicht einhalten.
Keine Erwartungen an Moskauer Wohlverhalten
Eagleburger lässt keinen Zweifel daran, was er für das effektivste Mittel hält, um eine solch düstere Zukunft zu verhindern: nämlich die Umwandlung ehemals sozialistischer Länder in „marktorientierte, verantwortungsbewusste Mitglieder der internationalen Gemeinschaft“. Dies sei die beste Garantie für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, könne aber nur gelingen, wenn ein Rückfall Russlands und der sowjetischen Nachfolgestaaten in den Totalitarismus vermieden werde.
In diesem Zusammenhang fordert der aus dem Amt scheidende Außenminister seinen Nachfolger auf, keine allzu großen Erwartungen an ein freundliches Verhalten Moskaus zu wecken. Angesichts des wachsenden Drucks der Opposition werde Boris Jelzin in der Balkanfrage mittelfristig deutlich weniger entgegenkommend sein und auch zeigen, dass Russland unabhängig vom Westen agiere.
Die Essenz von Eagleburgers Botschaft lässt sich mit Blick auf die neue Russlandpolitik der Vereinigten Staaten in drei relevanten Punkten zusammenfassen:
1. Washington müsse die Frage des sowjetischen Atomwaffenarsenals so schnell wie möglich lösen. Dazu gehöre es, sicherzustellen, dass alle Waffen in Russland konsolidiert werden und dass die Ukraine, Weißrussland und Kasachstan ihre Verpflichtungen zur Denuklearisierung erfüllten.
2. Washington müsse die Wirtschaftsreformen in Russland, also die Transformation der vormaligen sozialistischen Plan- in eine freie Marktwirtschaft, unterstützen. Die Notwendigkeit hierzu ergebe sich aus dem Umstand, dass die Geschichte nicht gut auf die USA blicken werde, wenn diese nicht großzügig helfen. Ein wichtiger Bestandteil der von Eagleburger beschriebenen Strategie war zudem die Unterstützung der Ausbildung von Russen in den USA und der amerikanischen technischen Hilfe für lokale Unternehmen in Russland.
3. Die USA sollten Jelzin und seinen Anhängern dabei helfen, ethnische und irredentistische Konflikte an der Peripherie zu vermeiden. Hierzu schreibt Eagleburger: „Wir wollen nicht, dass die Bedrohung russischer Minderheiten zu einem Problem für die Demokraten in Russland wird, aber wir wollen auch keine Erneuerung der russischen imperialen Kontrolle.“
Die Rolle der Reformen in Russland
Schließlich skizziert Eagleburger auch die wichtigsten Probleme im Umgang mit den anderen sowjetischen Nachfolgestaaten. Dabei erhebt er die Forderung, die Ukraine müsse dringend als unabhängiger Akteur und nicht als Anhang zu unseren Beziehungen mit Russland behandelt werden. Für die baltischen Staaten empfiehlt Eagleburger „mehr Großzügigkeit bei den Rechten der russischen Minderheit“, um den Abzug der russischen Truppen aus der Region zu beschleunigen.
Für Zentralasien rät er, Kasachstan mit seiner 45-prozentigen russischen Minderheit und seinen Atomwaffen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die übrigen Staaten würden jedoch wahrscheinlich noch lange Zeit politisch und wirtschaftlich instabil sein.
Dass Russland insgesamt eine wichtige Rolle bei der Transformation des gesamten postsowjetischen Raumes spielen werde, war für Eagleburger klar: „Der Erfolg der Reformen in Russland garantiert vielleicht nicht den Erfolg der Reformen in den anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aber wenn die Reformen in Russland scheitern, bedeutet dies auf jeden Fall das Scheitern der Reformen im gesamten ehemaligen Sowjetimperium.“
Man kann feststellen, dass die von Eagleburger vertretenen Positionen in der künftigen Russlandpolitik durchaus auf eine konstruktive Zusammenarbeit abzielten. Neben der berechtigten Sorge über die Entfesselung des sowjetischen Nuklearpotenzials sticht vor allem die Absicht ins Auge, Russland auf dem Weg in eine demokratische Zukunft zu unterstützen. Von dem Streben, Moskau in die Enge zu treiben oder es sukzessive zu marginalisieren, ist in Eagleburgers Ausführungen nichts zu sehen.
Dieser Eindruck wird auch durch das dritte veröffentlichte Dokument bestätigt. Dabei handelt es sich um ein Memo des US-Diplomaten und Russlandexperten Strobe Talbott an den neuen Außenminister Christopher Warren, das auf den Vorabend seines Treffens mit dem russischen Außenminister Andrej Kosyrew am 7. Februar 1993 datiert ist. Wie das Nationalarchiv in einem Kommentar erwähnt, zeigt das Dokument, welche Bedeutung die Clinton-Regierung der Frage der Reformen in Russland beimaß. Darüber hinaus eröffne es einen Einblick in das „beispiellose Ausmaß“ des persönlichen Engagements sowohl von Talbott als auch von Bill Clinton im Prozess der Demokratieförderung in Russland.
„Glänzende Zukunft“
In dem Memo schreibt Talbott, dass er, obwohl Russland und die ehemalige Sowjetunion das größte und gefährlichste politische Chaos auf der Welt darstellten, davon ausgehe, dass mit einem ausreichend hohen Maß an Unterstützung für russische Reformen durch die Vereinigten Staaten eine glänzende Zukunft“ zustandekommen könne. Mit anderen Worten: Wenn die USA die junge Russische Föderation bei ihrer Wandlung zu einer modernen Demokratie an die Hand nähmen, müsse das Ergebnis alle Erwartungen übertreffen.
Ferner stellt Talbott fest, dass der Zusammenbruch der UdSSR keine zweite Revolution in Russland nach 1917 darstelle, sondern drei Revolutionen auf einmal verkörpere: nämlich vom Totalitarismus zur Demokratie, von der Plan- zur Marktwirtschaft und vom Imperium zum Nationalstaat. Ungeachtet der Tatsache, dass der letzte Befund natürlich absurd ist, handelt es sich bei der Russischen Föderation doch gerade um einen Zusammenschluss von beinahe 100 Völkern, setzte Talbott große Hoffnung in die Zukunft. Den Untergang der Sowjetunion und die Geburt eines neuen demokratischen Staates auf ihrem Territorium bezeichnet er als „das größte politische Wunder unserer Zeit.“
In seinem Enthusiasmus geht Talbott sogar noch weiter, wenn er feststellt: „Wenn all das so weitergeht, könnte es in seinen positiven Auswirkungen mit der Entstehung unseres eigenen Landes, unseres Systems und unserer Rolle in der Welt vergleichbar sein.“
Insgesamt lässt sich sagen, dass die frühen Neunziger Jahre in den USA mit Blick auf Russland neben einigen Ängsten vor allem von einer großen Aufbruchsstimmung geprägt waren. In Russland selbst ist dies natürlich noch mehr der Fall gewesen. Auch hier gilt der von Goethe formulierte Grundsatz „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen“. In der Tat ist der weit verbreitete Enthusiasmus jener Tage heute noch nur Zeitzeugen gewahr. Umso besser, dass ihm die Scorpions ein musikalisches Denkmal gesetzt haben, das Millionen Zuhörer in seinen Bann zog.
„Stabiles europäisches System“
Was aber ist von all dem geblieben? Was wurde aus den beidseitigen Vorsätzen zu einer gedeihlichen und konstruktiven Zusammenarbeit? Warum gelang es nicht umzusetzen, was Eagleburger als „die allmähliche Eingliederung eines sich reformierenden Russlands in ein stabiles europäisches System“ bzw. „die Umwandlung ehemals sozialistischer Länder in marktorientierte, verantwortungsbewusste Mitglieder der internationalen Gemeinschaft“ bezeichnet hatte?
Obwohl an dieser Stelle nicht der Ort ist, diesen Fragen in gebührender Weise Rechnung zu tragen, möchte ich es mit einem erhellenden Zitat bewenden lassen. Dieses stammt aus der Feder von George F. Kennan – eines der bedeutendsten Russlandexperten, den die USA im 20. Jahrhundert hervorgebracht haben. Mit Blick auf eine ungewisse postsowjetische Zukunft hatte Kennan einst konstatiert:
„Würde die Sowjetunion morgen in den Fluten des Ozeans versinken, müsste der amerikanische militärisch-industrielle Apparat im Wesentlichen unverändert weitermachen, bis ein anderer Gegner erfunden werden könnte. Alles andere wäre ein inakzeptabler Schock für die amerikanische Wirtschaft.“
Was auch immer man von Kennans Gedanken halten mag, scheint doch ausgeschlossen, dass er auf der gestrigen Münchner Sicherheitskonferenz Beachtung gefunden haben könnte. Das ist zumindest insofern verwunderlich, als die amerikanische Rüstungsindustrie gerade eine Hochkonjunktur erlebt.