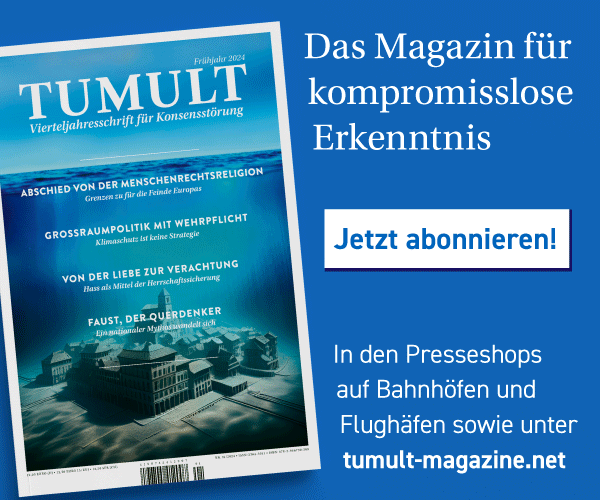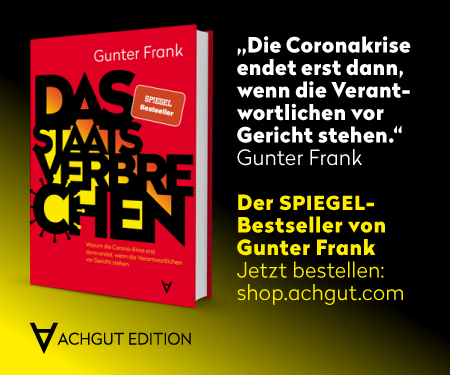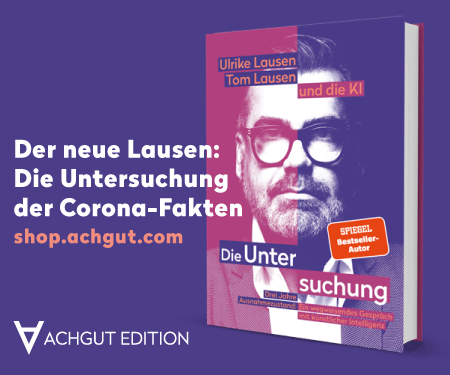Die PCR-Massentestung ist als Begründungsbasis für staatliche Maßnahmen aufgrund mangelnder einheitlicher Standards nicht einmal für sich allein betrachtet vernünftig, sie ist weder in sich stimmig noch wenigstens im Sinne des Infektionsschutzgesetzes rechtskonform. In einer sechsteiligen Beitragsreihe werden hier sämtliche Verstöße gegen die Gebote wissenschaftlich seriöser Datenproduktion, -erhebung und -präsentation dokumentiert. Sie könnten in Zukunft bei der Aufarbeitung der Krise und ihrer Folgen auch juristisch relevant werden. In der heutigen Folge geht es um die „Neuinfektionen“.
Als in Deutschland im März 2020 der gesundheitspolitisch begründete Ausnahmezustand herbeigeführt wurde, geschah dies zum einen im irrationalen Bann der „Bilder aus Bergamo“ und pseudowissenschaftlicher Horrorszenarien des Imperial College oder des RKI. Soweit zum anderen überhaupt auf in und für Deutschland erhobene Daten, die empirische Realität vor Ort, Bezug genommen wurde, war von einem exponentiellen Wachstum der Neuinfektionen die Rede, was einen steilen Anstieg neuer Erkrankungsfälle meinte. Diese Entwicklung sollte mittels radikaler bevölkerungspolitischer Maßnahmen (Kontaktminimierung durch Wirtschaftslockdown und Einschränkung von Freiheitsrechten) ausgebremst, die Infektionskurve abgeflacht werden (Flatten The Curve). Als Ziel wurde ausgegeben, die Verdoppelungszeit der Neuinfektionen auf 10 Tage (später 14 Tage) zu strecken bzw. den R-Wert (die Zahl an Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt) auf unter 1 zu drücken.
Spätestens am 15. April – mit den RKI-Veröffentlichungen des aktuellen täglichen Lageberichts und des epidemiologischen Bulletins – war die offizielle Seuchenpolitik den eigenen Daten nach als überflüssig und unverhältnismäßig überführt. Zur Erinnerung: Der umfassende Lockdown wird auf den 23. März datiert, am 25. März nahm der Bundestag das „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ an und stellte zugleich eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest – die Voraussetzung, um die neu ins Infektionsschutzgesetz eingefügten Ermächtigungsgrundlagen zu nutzen.
In den angesprochenen RKI-Berichten ist allerdings zu lesen und grafisch aufbereitet, dass die R-Zahl bereits vor dem 23. März auf unter 1 gesunken war. Der Höhepunkt der Anzahl an Neuerkrankungen (die gegenüber dem Meldedatum der Testergebnisse aufgrund des Verzugs von Inkubation, Symptombildung, Probenentnahme, Weiterleitung der Befunde 10–14 Tage vorzudatieren sind) war schon Mitte März überschritten. Und auch einen exponentiellen bzw. steilen Anstieg positiver Testergebnisse hatte es so nie gegeben bzw. wurde dieser Eindruck lediglich dadurch erzeugt, dass man, ohne dies der Öffentlichkeit entsprechend mitzuteilen, die Anzahl der durchgeführten Tests im Verhältnis zu den Vorwochen verdoppelte bis verdreifachte, weshalb sich auch die Anzahl der „Erkrankten“ mehr als verdoppelte bzw. verdreifachte.
Positivenrate oder absolute Zahlen
Da man jedoch prinzipiell mehr findet, je mehr man sucht, theoretisch also auch während des Abflauens eines realen Infektionsgeschehens durch Erhöhung der Testanzahl einen Anstieg der Fallzahlen produzieren könnte, wäre von vornherein einzig die Positivenrate (Verhältnis positiver Tests zur Testanzahl) relevant gewesen. Und diese stieg – als sie noch stieg (fürs Infektionsgeschehen wie gesagt um 2 Wochen vor die Meldedaten zu verlegen) – recht gemächlich von 5,9% (KW11: 127.457 Tests) auf 6,8% (KW12: 348.619 Tests) auf 8,7% (KW13: 361.374 Tests) auf den Höhepunkt von 9,1% (KW14: 406.052 Tests).
Als das Parlament am 25. März den Ausnahmezustand besiegelte, waren laut RKI-Lagebericht vom selben Tag in absoluten Zahlen kumuliert 31.554 Menschen (also 0,04% der Bevölkerung) „erkrankt“ (ohne Abzug der Genesenen, der Symptomfreien, der milden Fälle – zumal die Dunkelziffer zu vernachlässigen ist, sobald nicht auf symptomlos Infizierte, sondern ernsthaft Erkrankte abgehoben wird, denn diese machen sich in der Regel bemerkbar und werden von Ärzten und Krankenhäusern registriert). 0,04 Prozent der Bevölkerung – und das Infektions- und Erkrankungsgeschehen war längst rückläufig, was der Öffentlichkeit spätestens am 15. April im Nachhinein hätte klar werden können, während das RKI es früher gewusst haben dürfte.
Das Experiment „Ausnahmezustand wegen Erkältungswelle“ hätte abgebrochen werden, seine juristische Aufarbeitung beginnen müssen, da ein präventiver Notstand aufgrund abstrakter Konjunktive („Wir können das Schlimmste nicht ausschließen – Better save than sorry“) bis dato vom bürgerlichen Recht nicht vorgesehen war. Stattdessen ging es einfach weiter, und das Parlament weigerte sich noch im Sommer, die „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ für beendet zu erklären. Die PCR-Tests wurden auf eine Anzahl von über eine Millionen pro Woche gesteigert, mit einer Positivenrate von unter 1 Prozent, während weiterhin absolute „Neuinfektionszahlen“ kommuniziert wurden und alles gebannt auf einen absurd niedrig veranschlagten Schwellen-Inzidenz-Wert von 30–50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (also 0,03-0,05 Prozent) pro Woche starrte. Um diesen Schwellenwert nicht zu reißen, wurden auch im Sommer Reglements wie die Maskenpflicht beibehalten.
Jetzt im Winter (November/Dezember) wird der Eindruck vermittelt, die Situation sei schlimmer als in März/April, weil viel mehr Neuinfektionen zu vermelden sind und der Schwellen-Inzidenz-Wert fast überall deutlich überschritten wurde. Das ist aber kein Wunder und hat mit Unterschieden des realen Infektionsgeschehens zwischen Frühjahr und Winter überhaupt nichts zu tun. Sondern mit der Erhöhung der Testanzahl. Wurden seit Kalenderwoche 12 in März/April 350.000 bis 450.000 Testungen die Woche vorgenommen, so inzwischen drei- bis viermal so viel, in KW 45 z.B. 1.602.839.
Dass die gegenwärtige Situation ähnlich derjenigen vom Frühjahr ist, zeigt sich in ähnlichen Positivenraten.
Nochmal: Natürlich könnte es prinzipiell pragmatische Gründe geben, die Testanzahl zu erhöhen, etwa wenn es rein technisch um Kontaktnachverfolgungen geht. Geht es aber ums Erahnen eines tatsächlichen Infektionsgeschehens, um Inzidenzen und politische Reaktionen, dann müsste reflektiert werden, dass ein Inzidenzwert allein über die Positivenrate hätte definiert werden dürfen. Denn die absolute Zahl an Neuinfektionen wird von vornherein nicht nur vom realen Infektionsgeschehen bestimmt, sondern immer auch von der politischen Entscheidung, wie viel man testet. Damit ist objektiv Willkür gesetzt: Denn die Situation, die zum Lockdown nötigt, ließe sich über die Anzahl der Tests nach Gutdünken genauso herbeiführen wie vermeiden.
Änderungen der Testpopulation
Aber auch die (Entwicklung der) Positivenrate ist so, wie sie vom RKI ermittelt wird, keine verlässliche Zahl. Das RKI stellt die Pandemieentwicklung seit März gerne in einer Grafik dar, welche auf der x-Achse den Zeitraum von März bis zur jeweiligen Gegenwart und auf der y-Achse die absoluten Zahlen der täglichen oder wöchentlichen „Neuinfektionen“ (eigentlich: positiven Tests) verzeichnet. Dies ergibt dann – von einer Sommerflaute unterbrochen – zwei Wellen mit jeweils starken Anstiegen, wobei die zweite noch dramatischer aussieht als die erste. Zwar würde dieselbe Darstellungsmethode mit der Positivenrate (statt absoluten Zahlen) auf der y-Achse zwei etwa gleichgroße und gleichermaßen undramatische Wellen mit nur leichten Anstiegen zeigen, doch wäre auch diese Abbildung des gesamten Zeitraums unsinnig.
Jeder Schüler lernt, dass sich die Ergebnisse eines Versuches nur solange konsistent abbilden lassen, wie sich die Versuchsanordnung nicht ändert. Ändert man die Versuchsanordnung, sind die jeweils erhobenen Zahlen nicht mehr direkt aufeinander zu beziehen. Zum einen war aber, wie die ersten Artikel dieser Reihe gezeigt haben, das Messinstrument der PCR-Massentestung kein standardisiertes. Unterschiedliche Labore haben hinsichtlich der Zielsequenzen verschiedene PCR-Tests eingesetzt und diese für die Interpretation der Ergebnisse differierend gehandhabt. Die Frage, wie viele Ziele für die Meldung eines positiven Gesamtergebnisses nach wie vielen Zyklen detektieren müssen, wurde nicht nur uneinheitlich beantwortet, viele Labore änderten ihr Handling von Zeit zu Zeit und wurden mit der Zunahme der Testanzahl zulasten der Qualität zunehmend überfordert. Auch auf der anderen Seite, quasi der des Testobjekts, gab es keine Einheitlichkeit. Immer wieder wurde die zu testende Population von der nationalen Teststrategie neudefiniert. In seiner aktuellen Exceltabelle zu den Testergebnissen seit Testbeginn versieht das RKI die Kalenderwoche 46 mit einem Sternchen und erklärt:
Ab 03. November 2020 geänderte Testkriterien, Daten nicht direkt mit Vorwochen vergleichbar.
Diese Änderung der Testkriterien war keineswegs die erste, auch wenn das RKI auf die vorangegangen an dieser Stelle überhaupt nicht eingeht. Wikipedia schreibt mit Verweis auf RKI-Quellen zu den Neudefinitionen der Testpopulation:
Mit Stand vom 24. März 2020 sollten nur Menschen getestet werden, die respiratorische Symptome zeigten und zusätzlich bestimmte Kriterien erfüllten (bspw. Kontaktpersonen von Infizierten, Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Angehörige von Risikogruppen). Ab dem 24. April 2020 empfahl das RKI die generelle Testung aller Atemwegserkrankungen, da mittlerweile ausreichend Kapazitäten zu Verfügung stünden und die Erkältungssaison vorbei sei. Später wurde die Gruppe der zu testenden Personen weiter ausgedehnt, beispielsweise auf Reiserückkehrer. Für Herbst und Winter empfiehlt das RKI nun wieder einen sparsameren Umgang mit den knappen Testressourcen. […] Tests sollen auf Personen konzentriert werden, die starke klinische Symptome aufweisen, eine hohe Gefahr für einen schweren Verlauf haben oder ein hohes Risiko, weitere Personen anzustecken bzw. Teil eines Clusters zu sein.
Zwischen März und Dezember 2020 gibt es also schon allein wegen der wechselnden Testpopulation mindestens 4 Phasen auf der x-Achse, deren y-Daten nicht direkt miteinander verglichen werden können. Das hindert das RKI aber nicht daran, diesen Anfängerfehler wissentlich jeden Tag zu reproduzieren. Zum einen wird Stimmung mit Trivialitäten gemacht: Selbstverständlich findet man unter Menschen mit schweren Atemwegssymptomen um ein Vielfaches mehr positive Fälle als unter Gesunden. Selbstverständlich steigen mit dem Herbst die Zahlen von Atemwegserkrankten. Zum anderen publiziert man die wesentlichen Erkenntnisse so randständig und leise, als handelte es sich um Nebensächlichkeiten: Es gibt nach aktuellen RKI-Daten insgesamt nicht mehr Atemwegserkrankte und Hospitalisierungen als in den Vergleichswochen und Monaten des Vorjahres (2018/2019) und damit weniger als 2017/18 während einer schweren Grippewelle. Die PCR-Massentestung vergrößert mit der Lupe, was nach eigenen Angaben unterm Radar der herkömmlichen Methoden des RKI zur Seuchenbeobachtung bleibt und „auf Bevölkerungsebene“ nicht wahrnehmbar ist. Und dann ist die Massentestung samt Datenerhebung und -präsentation auch noch für sich völlig konfus.
Sachliche Konsequenzen und juristische Implikationen
Auf der einen Seite ein uneinheitliches Handling verschiedener Testdesigns (Folge 1 und 2), auf der anderen Seite wechselnde Testpopulationen, dazu: keine Bereinigung der Zahlen von „Neuinfektionen“ um Mehrfachtestungen und Nachmeldungen im Zusammenhang von Probenrückstaus (Folge 4), keine Reflexion auf Falsch-Positive, die mit der Testung nicht-symptomatischer Menschen und der Überforderung der Labore durch Ausweitung der Testanzahl sehenden Auges vermehrt werden (Folge 3) – all das ergibt einen inkonsistenten, nichtssagenden Zahlensalat, der die Berechnungsgrundlage für Parameter bildet, die als jeweilige „Mutter aller Zahlen“ (Überschreiten des Inzidenz-Werts) weitreichende Konsequenzen für die Bevölkerung haben. Abgesehen von der Verfassungswidrigkeit des parlamentarischen Mehrheitsbeschlusses, angesichts einer Infektionskrankheit, von der das RKI mit den herkömmlichen, seit Jahren etablierten Instrumenten der Seuchenbeobachtung überhaupt nichts zu sehen vermochte und vermag, Grundrechte dem Infektionsschutz unterzuordnen, ist jede einzelne Maßnahme juristisch fragwürdig, sofern sie sich auf ein reales Infektionsgeschehen und seine Entwicklung bezieht. Denn selbst das reformierte Infektionsschutzgesetz definiert Infektion (in §2) immer noch als Aufnahme eines vermehrungsfähigen Agens im menschlichen Organismus und seine nachfolgende Vermehrung. Der PCR-Test allein kann dies auf individueller Ebene aber so wenig nachweisen, wie die vor handwerklichen Fehlern oder durchsichtigen Propagandakniffen nur so strotzende PCR-Massentestung auf gesellschaftlicher.
Hat sich die PCR-Massentestung samt der sie begleitenden Statistik in epidemiologischer Hinsicht als geballter Unsinn erwiesen, stellt sich noch die Frage nach dem medizinisch-klinischen Nutzen einer pcr-gestützten Corona-Diagnose für den einzelnen Patienten. Darum geht es in der nächsten und letzten Folge.
Teil 1 finden Sie hier.
Teil 2 finden Sie hier.
Teil 3 finden Sie hier.
Teil 4 finden Sie hier.