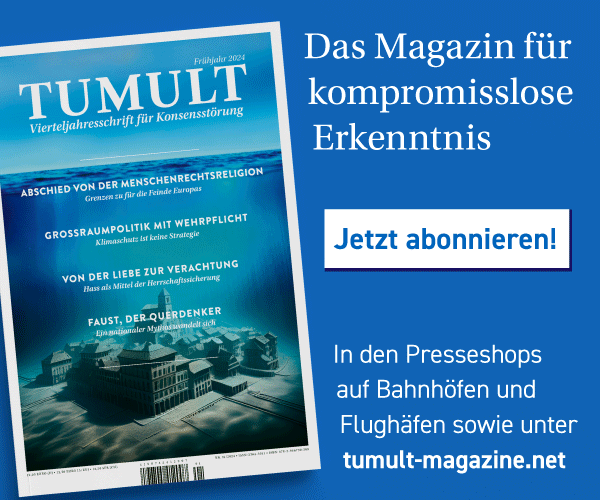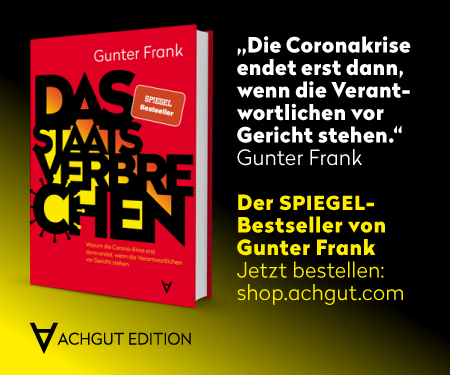Im „Bericht zur Weltungleichheit 2018“ gibt es eine Zahl, die den Dauerkonflikt der arabischen Staaten mit Israel plötzlich in sehr klares Licht stellt. Ein internationales Forscherteam – koordiniert unter anderem von dem französischen Ökonomen Thomas Piketty („Das Kapital im 21. Jahrhundert“) – untersuchte, wie gleich (beziehungsweise ungleich) sich das Einkommen in verschiedenen Weltgegenden innerhalb der Länder verteilt. Die größte Ungleichheit fanden sie in dem am 14. Dezember 2017 veröffentlichten Report nicht in den USA oder Asien – sondern im Nahen Osten.
Während in Europa die obersten zehn Prozent der Gesellschaft 37 Prozent aller Einkommen kassieren, in China 41 und in den USA und Kanada 47 Prozent, fließen im Nahen Osten 61 Prozent aller Einkommen in die Taschen des obersten Zehntels.
Die extreme Einkommensungleichheit, so die Wissenschaftler, sei dort nicht erst in wenigen Jahren gewachsen. Sie bewege sich schon seit langem auf hohem Niveau.
Zu dem krassen sozialen Gegensatz in dieser Weltgegend trägt weniger Israel bei, ein Hochtechnologieland, dessen Wertschöpfung pro Kopf 2016 bei 37.292 Dollar lag. Vor allem in den umliegenden arabischen Staaten fällt der Gegensatz zwischen Armen und einer kleinen privilegierten Gruppe sehr krass aus, ganz besonders ausgeprägt in der West Bank und Gaza (Wertschöpfung pro Kopf 2009: 3.100 Dollar), aber auch in Jordanien und Syrien.
Trotz der niedrigen Produktivität und hohen Arbeitslosigkeit (Jugendarbeitslosigkeit: 58 Prozent) gibt es durchaus Wohlstand und Reichtum, gibt es Villen mit Pools – allerdings eben für sehr wenige. Anders als in europäischen Medien gern berichtet, fehlen auch keine Waren in Geschäften; es gibt insbesondere keine Knappheit an Baumaterial. Anderenfalls wäre es der Hamas auch kaum möglich, ständig neue betonverschalte Angriffstunnel auf israelisches Territorium vorzutreiben. Erst vor wenigen Tagen sprengte die israelische Armee wieder eine dieser gut ausgestatteten unterirdischen Angriffswege.
Es mangelt nicht an Geld
Es mangelt generell nicht an Geld im Gazastreifen und der Westbank, im Gegenteil. In kaum eine andere Weltgegend fließen so viele Hilfsmittel wie in den 365 Quadratkilometer großen Gazastreifen, in dem 1,8 Millionen Menschen leben. Allein zwischen 2008 und 2012 zahlte die EU nach Angaben des Europäischen Rechnungshofes etwa eine Milliarde Euro für gut 70 000 Angestellte der Fatah-beherrschten Autonomiebehörde, die seit der Machtübernahme der Hamas im Jahr 2007 in Wirklichkeit ohne Beschäftigung sind. Sie gehören zu den Privilegierten, ebenso wie hohe Hamas-Funktionäre. Die Terrororganisation betreibt beispielsweise die hoch profitablen Schmuggeltunnel unter der abgeriegelten Grenze nach Ägypten, was ihnen erlaubt, eine Importsteuer in Höhe von von 25 Prozent des Warenwertes auf alle Güter zu erheben.
Neben der EU überweisen auch die USA jährlich dreistellige Millionensummen an die Autonomiebehörde in der Westbank. Große Teile des quasistaatlichen Apparates werden aus Europa und den USA finanziert. Trotz der offiziell behaupteten Armut ist die Behörde unter Präsident Mahmut Abbas in der Lage, den Familien von Terroristen, die in israelischer Haft sitzen, eine Art Gehalt zu zahlen. Das liegt nach Angaben des Middle East Research Institute (Memri) monatlich bei 364 Dollar bei Haftstrafen unter drei Jahren; bei Verurteilungen ab 30 Jahren beträgt die Unterstützung 3.120 Dollar. Zum Vergleich: der Mindestlohn in der Westbank liegt nach Angaben des palästinensischen Statistikbüros bei 298 Dollar monatlich, in Gaza bei 209 Dollar.
Wer also zur politischen Führungsschicht zählt, kann selbst in Gebieten ohne funktionierende Wirtschaft sehr komfortabel leben. Reich wird nicht, wer etwas gründet und produziert, sondern, wer im Machtgefüge an der richtigen Stelle sitzt.
Märtyrerfamilien können sich zumindest einen relativen Wohlstand leisten. Für den Rest bleibt tiefe Armut. Laut CIA-Handbuch werden etwa 95 Prozent der im Gazastreifen produzierten Güter auch dort von den privaten Haushalten verbraucht. Das heißt: das Gebiet exportiert – abgesehen von Raketen nach Israel – praktisch nichts. Als Haupteinnahmequelle dienen die Überweisungen aus dem Westen. Die ständige Behauptung, von Israel ins Elend gedrückt zu werden – Pallywood inklusive – ist gewissermaßen die palästinensische Industrie.
Natürlich treibt vor allem die islamistische Ideologie die Feindschaft den Feind Israel an. Aber der beständig gepflegte Hass gegen den wirtschaftlich erfolgreichen jüdischen Staat empfiehlt sich auch als probates Mittel, um die Masse der Bevölkerung ruhig zu halten und ihren Hass zu kanalisieren, der sich sonst gegen die eigene Oberschicht richten würde. Würde er angesichts der schreienden sozialen Ungleichheit in die Richtung der eigenen Eliten explodieren, gäbe es vermutlich nicht nur ein paar „Tage des Zorns” wie nach der Jerusalem-Entscheidung Donald Trumps.
In deutschen und generell in europäischen Medien tauchen Bilder von Villen in Gaza und der Westbank praktisch nie auf, sondern fast durchgängig Filmaufnahmen, Fotos und Berichte, die das Bild eines generell bitterarmen Landes zeichnen, in dem die Volksgemeinschaft einmütig das Elend teilt. „Gaza ist ein Gefängnis. Ein Lager“, verkündete etwa Jakob Augstein, der nach eigenen Angaben nie in Israel oder den Palästinensergebieten war, und – ebenfalls nach eigenen Angaben – auch nicht beabsichtigt, dorthin zu reisen.
Er und andere deutsche Medienvertreter beschäftigten sich auch in der Vergangenheit so gut wie nie mit dem Millionärsleben, das Yassir Arafats Frau Suha in Paris führte. Ebenfalls nicht auf der Agenda: die Tatsache, dass palästinensische Flüchtlinge im Libanon jahrzehntelang von praktisch allen gut bezahlten Berufen per Gesetz ausgeschlossen wurden – ein Zustand, der auch dort Teilung in wenige Wohlhabende und viele Arme zuverlässig konserviert.
Lieber werfen Sigmar Gabriel und Aktivisten antiisraelischer Organisationen Israel vor, ein „Apartheidstaat“ zu sein. Und fördern die Verschickung von weiteren Steuermillionen in den Nahen Osten, ohne zu fragen, in wessen Händen das Geld landet.
Dieser Beitrag erschien zuerst in Alexander Wendts Magazin Publico hier.