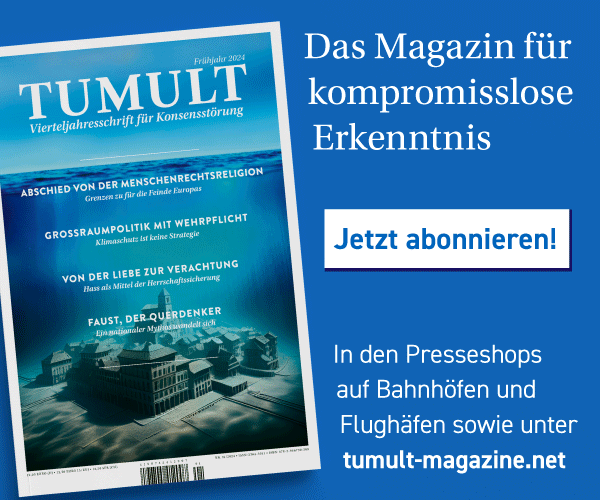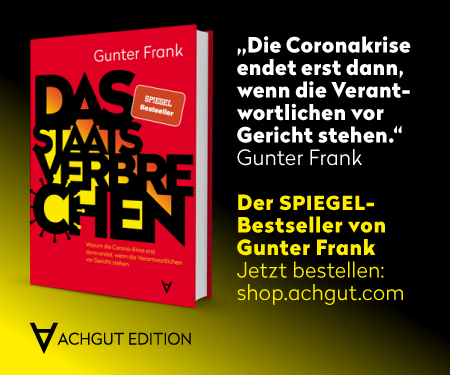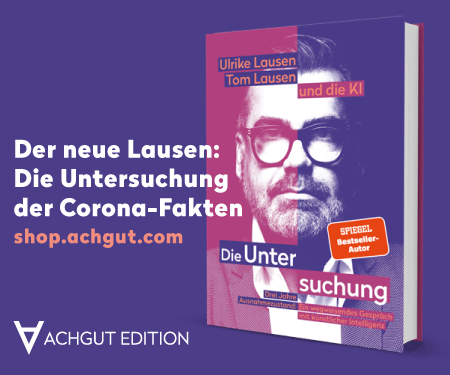Eine Inszenierung am Münchner Gärtnerplatztheater wagte es, aus historischen Gründen mit Blackfacing zu arbeiten. Der Aufschrei kam, das Haus übte Selbstkritik – und stampft die brandneue Produktion wieder ein.
Das N-Wort darf man nicht schreiben. Das N-Wort darf man nicht aussprechen. Das N-Wort darf man nicht einmal denken. Selbst wenn man das N-Wort aus einer historischen Perspektive betrachten wollte, wenn man schriebe, dass es einmal Menschen gegeben habe, die andere Menschen mit einem dunkleren Teint als hellhäutige Rassisten mit dem N-Wort tituliert hätten, wäre das streng verboten. Denn das N-Wort hat nie existiert. Es ist das perfekte Tabu.
Auch „Blackfacing“ hat es nie gegeben. Mit „Blackfacing“ bezeichnete man eine Praxis, mit der sich Kinder, meist zum Fasching, mittels dunkler Schminke in einen Träger des N-Wortes verwandelt haben. Außerdem gab es das „Yellowfacing“ und das „Redfacing“, unverzichtbar für die beliebten Kinderspiele „Kaiser von China“ sowie „Cowboy und Indianer“, wobei das Wort Indianer ebenfalls nie existiert hat.
Heute würde man Träger des I-Wortes wohl als US-amerikanische Aborigines bezeichnen, verbunden mit dem Hinweis, dass sich hinter der Bezeichnung „Amerika“ für die große Landmasse auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans der Vorname des italienischen „Entdeckers“ und Händlers Amerigo Vespucci verbirgt, der zeitgleich mit Christoph Kolumbus die schändliche Epoche der europäischen Ausplünderung des A-Kontinents eingeleitet hatte.
„Langweiliges und geistloses Stück“
Blackfacing war lange Zeit auch auf Theaterbühnen weit verbreitet, wenn nämlich weißhäutige Schauspieler oder Sänger andersfarbige Charaktere verkörpern sollten, etwa den Otello in Giuseppe Verdis gleichnamiger Oper, den Bassa Selim in Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“, einen Chinesen in Giacomo Puccinis „Turandot“ – oder den Jonny in Ernst Kreneks Opernkomödie „Jonny spielt auf“.
Jüngst hatte das selten gespielte Werk Premiere am Münchner Gärtnerplatztheater, dem kleinen, fürs eher leichte Musiktheater zuständigen Bruder der Bayerischen Staatsoper. Der turbulente Zweiakter handelt von dem afroamerikanischen Jazzmusiker Jonny, der einem Violinvirtuosen eine wertvolle Meistergeige stiehlt und mit dem Instrument am Ende allerlei amouröser und sonstiger Verstrickungen den Jazz zur Weltmusik macht: „Es kommt die Neue Welt übers Meer gefahren mit Glanz und erbt das alte Europa durch den Tanz!“
„Jonny spielt auf“ wurde 1927 in Leipzig uraufgeführt und zu einem Sensationserfolg. Bei der Münchner Erstaufführung im Jahre 1928 kam es zu einem Skandal, als Rechtsradikale mit Krawall und Stinkbomben für ein vorzeitiges Ende der Vorstellung sorgten. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 im Deutschen Reich wurde „Jonny spielt auf“ verboten und fristet seither wie andere Werke einst „verfemter“ Komponisten ein Schattendasein. Ob die Oper musikalisch ein großer Wurf war, soll dahingestellt sein. Kreneks Komponistenkollege Hanns Eisler nannte sie ein „langweiliges und geistloses Stück“, wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass er Ernst Krenek (1900-1991) ansonsten für einen sehr begabten Komponisten halte.
„Das wäre gelogen und Geschichtsverzerrung“
Das Gärtnerplatztheater hatte mit der Ausgrabung des verstaubten Renners aus den „Goldenen Zwanzigern“ nur Gutes im Sinn. Regisseur Peter Lund wollte die Entstehungsgeschichte der Oper selbst zum Thema machen und, wie er in einem vorab erschienenen Interview sagte, „die Situation von damals historisch genau“ abbilden. Dazu gehörte für ihn auch das Blackfacing, wobei der Jonny-Darsteller selbst auf der Bühne in den schwarzen Schminketopf greift und sich später auch wieder selbst abschminkt. „Wenn ich das mit einem Schwarzen besetzt hätte“, sagte Lund, „wäre es ein ganz anderes Bild. Dann würde ich behaupten, 1928 hätten schwarze Sänger in Deutschland gesungen. Das wäre gelogen und Geschichtsverzerrung“.
Die Premiere am 11. März ging ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne und die Kritiken hernach waren meist wohlwollend. Lund arbeite viel mit Klischees, sagte der Rezensent von Deutschlandfunk Kultur. Die ganze Gesellschaft trete bewusst in „sehr exaltierten Kostümen“ auf. Insofern passe es auch, „was den historischen Kontext betrifft, durchaus, dass man eben ganz bewusst dieses Blackfacing zeigt, markiert und auf der Bühne darstellt“. Mit seiner Feststellung, dass der schwarz geschminkte Hauptdarsteller „kein Aufreger“ gewesen sei, hatte sich Peter Jungblut in seiner Besprechung für den Bayerischen Rundfunk allerdings gründlich geirrt.
Denn der Social Media-Mob stand schon Kotkübel bei Fuß. „Dass ihr das 2022 immer noch völlig unberührt von der Rassismus-Debatte so umsetzt ist skandalös und hochnotpeinlich“, geiferte die Internet-Aktivistin Jasmina Kuhnke alias „Quattromilf“, die sich selbst als „afrodeutsche Serbokroatin oder serbokroatische Afrodeutsche“ bezeichnet.
Blackfacing hat es nie gegeben
Schützenhilfe erhielten sie und ihre Follower vom Kulturredakteur der Münchner Abendzeitung, der dem Stück selbst rassistische Tendenzen bescheinigte. Es sei naiv zu glauben, aus einem Verbot der Oper durch die rassistischen (sic!) Nazis folgern zu können, das Werk sei politisch unschuldig. Frösteln machte schließlich ein von mittlerweile fast 600 Kulturschaffenden unterschriebener Offener Brief an die Leitung des Gärtnerplatztheaters mit der Forderung, die Produktion umgehend abzusetzen, verbunden mit einem Boykottaufruf an das Publikum, „das rassistische Blackfacing auf großer Bühne nicht über Eintrittsgelder mitzufinanzieren“.
„Um über Rassismus zu sprechen oder ihn zu reflektieren, muss man ihn nicht reproduzieren“, heißt es in dem Schreiben. „Wäre Ihnen an einer tatsächlichen Auseinandersetzung gelegen, hätten Sie hierbei zuerst und an vorderster Stelle Schwarze Künstler:innen beteiligen und zu Wort kommen lassen müssen. Dass Sie sich stattdessen mit einem gänzlich weißen Regieteam zu einer plumpen Reproduktion des Blackfacings entschieden haben und dieses stolz und hartnäckig verteidigen, ist falsch und jedenfalls kein Zeichen ernsthaften Interesses an einer redlichen, rassismuskritischen historischen Aufarbeitung der Inszenierungsgeschichte dieser Oper an Ihrem Haus.“
Es kam, wie es kommen musste: In einem peinlichen Kotau versicherte das Gärtnerplatztheater am 20. März, „bei allen künftigen Aufführungen“ aufs Blackfacing zu verzichten. Doch dem Mob war dies „not enough“, wie eine Reihe von Aktivisten bei der dritten Aufführung im noch abgedunkelten Zuschauerraum auf einem Laptop-Bildschirm kundtaten. Auf Achgut-Anfrage bestätigte das Theater nun, dass nach dem laufenden Aufführungszyklus auf eine Wiederaufnahme der Inszenierung verzichtet werde. Im Klartext: Die brandneue Produktion wird ebenso eingestampft wie das Programmheft, in dem Regisseur Lund seine Entscheidung fürs Blackfacing so wortreich und normgerecht „kontextualisiert“ hatte. Dass in der Inszenierung schwarze Tänzer auftreten, die das Blackfacing kommentieren und nach Auskunft des Hauses während der Proben nach ihrer Meinung gefragt wurden, interessierte die Cancel-Community nicht. Lund hätte es wissen müssen: Blackfacing hat es nie gegeben.
Sollen die Werke ganz von den Spielplänen verschwinden?
Unterdessen fragen sich nicht nur die frustrierten Mitarbeiter des Gärtnerplatztheaters, wie man in Zukunft Opern mit fremdländischem Kolorit noch inszenieren soll, wenn man alle nicht-weißen Rollen nur mit entsprechenden „People of Colour“ besetzen soll, einschließlich des Regieteams. Dummerweise ist die Oper immer noch eine primär europäische, „weiße“ Kunstform und das Portfolio geeigneter farbiger Darsteller begrenzt. Oder sollen die Werke ganz von den Spielplänen verschwinden?
Im Sommer wird bei den Bregenzer Festspielen als Hauptwerk auf der Seebühne „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini gegeben. Auf der Besetzungsliste dieser in einem imaginierten Japan spielenden Oper findet sich, abgesehen von Darstellern aus einigen mittelasiatischen Staaten, kein einziger Künstler, der den Maßstäben einer Person „of colour“ gerecht würde. Auf Nachfrage meinte der Pressesprecher des Festivals, Herkunft oder Nationalität seien ebenso wenig Maßstab für die Besetzung von Opernrollen bei den Bregenzer Festspielen wie beispielsweise Religionszugehörigkeit und sexuelle Orientierung. „Vielmehr sind künstlerische Qualität und Teamfähigkeit entscheidende Kriterien für ein Engagement.“
Solch eine Selbstverständlichkeit öffentlich auszusprechen, ist heute schon mutig.