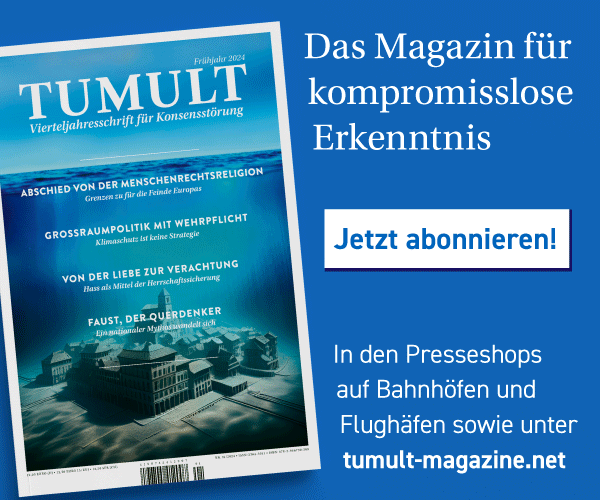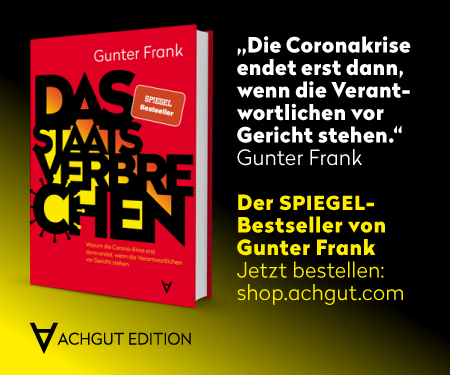Je ungenauer die Wortwahl, desto manipulativer ist Sprache einsetzbar. Je mehr ich im Unklaren lasse, desto leichter kann ich Inhalte beimischen, die eigentlich unpassend sind, die mit dem Eigentlichen, mit dem Ausgedrückten nichts zu tun haben, jedoch dem Zwecke der Manipulation dienen. Sie dienen dann etwa dazu, jemanden zu ängstigen. Wage Andeutungen, so als wisse man alles, wolle es dem Zuhörer in aller Direktheit jedoch nicht zumuten. Hehre Ziele, so als könnten diese als selbstverständlich vorausgesetzt werden, als sei ihre Überprüfung ob ihres Wahrheitsgehaltes überflüssig. Schlagwörter, wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Faschismus, Rechts, Klimawandel, Gerechtigkeit, Gleichheit, Hass, Hetze, usw. werden dem Zuhörer um die Ohren gehauen, ohne ohne dass es offenbar einer Überprüfung ihrer angemessenen Zuordnung bedarf. Sie werden als bereits hinreichend erklärt und bewiesen, vorausgesetzt. Ihr Verständnis wird vorausgesetzt. Dabei sind sie völlig willkürlich, jedoch mit Bedacht gewählt. Ihr Zweck ist Manipulation. Ihr Zweck ist Tabuisierung. Ihr Zweck ist Mundtotmachung. Der Sprache wird in ihrem bewusst oberflächlichen Gebrauch Gewalt angetan und damit wird den Menschen Gewalt angetan, die dieser Sprache ausgesetzt sind. Darin besteht die Macht über Worte. Eine Spachhoheit. Diese Macht wird brachial eingesetzt.
Mit der Behauptung, bei der Befassung mit dem Eigentlichen handele es sich um einen blossen “Jargon”, also hier nur um einen bedeutungsheischenden Nominalismus, hat man diese Befassung nicht nur polemisch bekämpft, sondern auch gleich ganz abgeschafft, denn die ontologischen Fragestellungen, die mit der Moderne aufkamen, hielt man als Materialist weder für wichtig noch war man ihnen überhaupt irgendwie gewachsen. Dass die Apologeten dieser Leute sich heute selbst in ihrem kruden Nominalismus verheddert haben, ist die Ironie an dieser Geschichte.
„Weißt du wo der Bahnhof ist?“ „Nein. Aber gut dass wir darüber geredet haben.“ Dies zeigt die Intention der Pseudowissenschaftler: Keinen interessiert es, wo der Bahnhof wirklich ist; es könnte sich ja herausstellen, dass einer Unrecht hat oder gar alle beide. Hauptsache wir haben darüber geredet. Diskurs als Ersatz für Realität. – Für Diskurs hoch zwei gibt es das Smartphone: mitreden von zuhause und unterwegs; liken, sharen, dissen. Nichts mehr mit kritischer Theorie, nichts mit Verifizierung und Falsifizierung; nichts mit These, Antithese, Synthese. Denken war gestern; heute ist Schnattern. Derweil bauen Amerikaner und Chinesen das Morgen. Völlig unfeministisch und deshalb höchst effizient.
Die besten und präzisesten Formulierungen und Detaillbeschreibungen entstehen im Geiste seines Schöpfers dann, wenn er sich am Feinde abarbeitet! Sein Haß auf Heidegger ließ Adorno zur Höchstform auflaufen. Dennoch ist die von ihm so wortgewandt beschriebene Taktik nahezu so alt wie die Welt selbst; die richtige Verpackung bringt die Ware leichter an den Mann und die Männin. Das ist bei der eigens zur Agitation konzipierten Gender-und Ökoterminologie nicht anders, als in den Verwandlungshows auf RTL, wo aus einer häßlichen Schabracke mit Mühe, großem Aufwand und schickem Kleidergedöne noch ein ansehnliches Stück Mensch erarbeitet wird. Nach kurzer Zeit, und dem ständigen Hinweis auf den Erfolg, ist der illusionsbereite und anpassungswillige Zuschauer bereit, seine Anerkennung mittels Applaus zu demonstrieren. Mehr, war nie beabsichtigt.
Lustig an der Kritik Adornos an “Sein und Zeit” und Heideggers gezielt ungenauen Stil ist, dass genau dieselbe Kritik auch auf das in ungenauen Begriffen schwelgende Geraune Adornos selbst zutrifft. Auch hier geht es nicht um Stil und Denken, sondern um politische Gesinnungen. Das Goethesche bzw. Faustsche “Such’ er den redlichen Gewinn, Sei er kein schellenlauter Thor! Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor!” ist beiden “Philosophen” ins Gebetbuch zu schreiben. Gerade Adorno war extrem selbstverliebt in seine verschwurbelten Sätze und noch verschwurbelteren Gedanken, da steht er Heidegger in nichts nach. Die derzeitige Debattenkultur (allen Anschein ein im ganzen Westen anzutreffendes Phänomen) hat damit nichts zu tun. Denn Adorno und Heidegger waren, bei aller berechtigter Kritik an ihrem stilistischen Schwulst und dem Begriffsgeckentum, immerhin denkfähig. Adorno als Gewährsmann taugt nichts, Schopenhauer muss her.
Adorno, naja. Der war aber leider kein guter marxistischer Lehrer, im Gegensatz zu etwa Ludwig Renn, mit dem man dagegen sagen kann: Menschen haben die Worte erschaffen und Menschen können sie auch umschaffen. Und Menschen können das Umschaffen (meint: die kritische Prüfung des Gehalts) einstweilen verhindern, früher kirchlicherweise mit dem Schwert, in Deutschland neuerdings bevorzugt mit Geschrei und Schemelbeinen. Worte haben schliesslich kein Eigenleben, jedenfalls wenn wir Magie ausschliessen.
Jargon, um die Anderen aus zu grenzen - ja, das hat was für sich. Und indem man derartige Grenzen aufbaut, fühlt man sich viel besser, besonders als die anderen - die diesen Jargon nicht haben. Das ähnelt einem Nationalismus, der versucht anderen die eigene Nation auf zu drängen.
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.