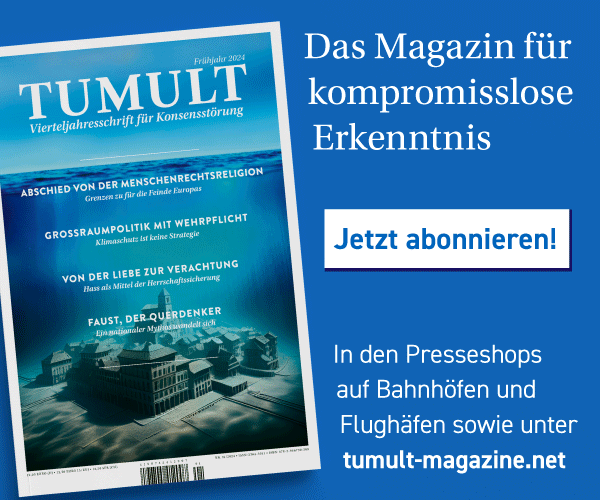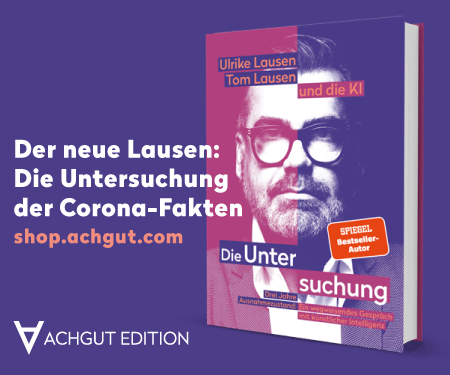Apropos Mathematik: Im Bundeswettbewerb Mathematik belegten letzte Woche 2 Schüler aus Sachsen die ersten Plätze. Bei so viel brainstorming auf dieser Zugverbindung muss man sicher einen erheblichen Zuschlag zahlen, auch wenn er sich nicht immer lohnt. Doch dafür kann die Bahn wirklich nichts.
Die Frage nach der Inklusion fällt mir der Förderschule. Ihr systematischer Abbau stellt ein Ergebnis der UN-Behindertenrechtskommission dar, die seit März 2009 Bund, Länder und Kommunen zur Durchsetzung eines ‘gemeinsamen Unterrichts’ verpflichtet hat. Die rechtliche Grundlage stellt der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 dar, die am 30. März 2007 von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist. Ihm zufolge dürfen “Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden”. In den Augen ihrer Kritiker erscheint vor allem die Sonderschule als Hindernis für diese Prinzipien. Sie verhindere das Erreichen von Qualitätsstandards und sei für mangelhafte Anschlussfähigkeit an die weitere Beschulung sowie für das Erwerbsleben verantwortlich. In der Konsequenz müsse demzufolge der gemeinsame Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen gefördert werden. Die ‘Inklusionsbeauftragten’ stellen eine notwendige Konsequenz aus den UN-Richtlinien dar, die über kurz oder lang auch in Sachsen durchgesetzt werden, wie es ein “erster Aktions- und Maßnahmeplan” vom 30. Mai 2012 umzusetzen meint. Die Umsetzung der Inklusion findet in der Praxis jedoch ihre Grenzen. In allgemeinbildenden Schulen arbeiten nicht genügend Lehrkräfte mit einer sonderpädagogischen Qualifikation. Defacto müssen ordentliche Lehrer die Schüler im gemeinsamen Unterricht beaufsichtigen und Lehrpläne erstellen, für deren Betreuung sie nicht hinreichend ausgebildet sind. Inklusion erweist sich als ein zweischneidiges Schwert. Einerseits lernen Schüler mit Menschen umzugehen, die “anders” wirken. Andererseits bedeutet auch deren Teilnahme am gemeinsamen Unterricht eine Einbuße an Unterrichtsqualität. Wie soll man reagieren, wenn ein verhaltensauffälliger Schüler die Kontrolle über seine Aggressionen verliert? Wie bewertet man eine offenkundige Leserechtschreibschwäche? Wie vermittelt man Wissen an jemanden, der an Autismus leidet? Grundsätzlich geht es doch um die Fragen, ob nicht an einer Förderschule solche Probleme besser gelöst werden könnten und ob sie überhaupt im Widerspruch zum Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention steht.
Interessant! Und vorbildlich, daß sie da interveniert haben! Infragestellung von PISA gab es nicht? Da hätten mich die Argumente der Inkludiererinnen interessiert, besonders der nun ja so gut wie verhinderten “Mathematikerin”. (Das war bei den ersten PISA-Ergebnissen, die ich noch “aktiv” - in Nds. - miterlebt habe, der erste Reflex. Ich denke, das hat sich kaum geändert.)
BaWü ist inzwischen auf dem besten Wege, NRW und Niedersachsen schulleistungstechnisch zu unterbieten. Die Gemeinschaftschulen werden gepushed, die verbindliche Schulempfehlung wurde abgeschafft. Das hat zur Folge, dass die Zahl der Sitzenbleiber in Realschulklasse 5 um 500% gestiegen ist. Gottseidank gibt es jetzt von der Landesregierung erfolgsversprechende Gegenmaßnahmen. Nein, keine Angst, die Schulempfehlung wird nicht wieder eingeführt. Grünroter Logik entsprechend werden stattdessen, man darf raten, ... die Noten in Klasse 5 und 6 abgeschafft. Das letzte Hindernis für den Übergang zur Realschule wird also abgeschafft. Das hat das politisch gewollte Ausbluten der Hauptschule zur Folge, die Realschule wird zur Hauptschule und geht in den nächsten Jahren in der Gemeinschaftschule auf. Dann endlich hat Grünrot das Ziel der Bildungsnivellierung auf niedrigster Stufe geschafft, Inklusionsschüler haben keine Probleme mehr, mitzuhalten. Wie ich gehört habe, freuen sich die Unis schon auf den Ansturm der neuen Schülergeneration;-)
Ich habe 3 Jahre in einem Inklusionssystem als Lehrer einer Oberstufe gearbeitet. Wer die offensichtlichen Nachteile des Systems anspricht/kritisiert gilt bei Systemverfechtern als unfähig, anpassungsunwillig, unflexibel, überholt und nicht lösungsorientiert/visionär. Der Lehrer soll nach diesem System gleichzeitig die extrem Schwachen bis zum extrem Leistungsfähigen alle adäquat betreuen, bzw. die Kinder zur gegenseitigen Hilfe oder Selbsthilfe anleiten. (starke Schüler werden gezwungenermassen als Gratisvermittler ohne Bezahlung ausgenutzt auf Kosten ihres Vorwärtskommens, obwohl von deren später einmal zu bezahlenden Steuern/geschaffenen Arbeitsplätzen/erbrachten Leistungen auch Schwächere oder Grüne/Linke mit Fantasieprojekten, die bezahlt werden müssen - wie die Inklusion - profitieren würden.) Aufgrund der riesigen Unterschiede fachlich und sozial und mehrerer Gruppen mit unterschiedlichen Betreuungsansprüchen ist eine Anleitung/Kontrolle pro Gruppe durch eine einzelne Lehrkraft oft nur unzureichend möglich. Schüler, welche nicht selbstständig arbeiten können, sind meist völlig überfordert. Eine Klasse mit vielen Querulanten wird v.a. still gehalten, damit Motivierte/Selbstständige wenigstens noch vorwärts kommen können. Einige einzelne Schüler werden dabei von Förderlehrern während einzelnen Lektionen betreut. Der Hauptlehrer sollte dabei durch regelmässige Absprachen den Überblick behalten, wer wo steht und sicherstellen, dass jeder Schüler für seine Verhältnisse Fortschritte macht - oder zumindest diesem Eindruck gerecht wird. (bei gleicher Anzahl Schüler und Lektionen wie im nicht durchmischten System) Die Idee, dass schwächere von stärkeren Schülern profitieren können, halte ich überhaupt nicht für falsch, aber nicht im oftmals vorherrschenden Ausmass oder ausschließlich/absolut! Die langfristigen Folgen für den Leistungsstand einzelner Betroffener sind im Vergleich zu homogener eingeteilten Gruppen teilweise fatal. Als im Beruf stehender Lehrer dies öffentlich anzusprechen kann gefährlich sein, sofern man - trotz allem - seinen Beruf weiterhin ausüben will. Ihr Ansatz, den gemessenen Schulerfolg des Systems als Hauptkriterium zu nehmen (unter Berücksichtigung des Vergleichs von Schülern mit ähnlichen Startvoraussetzungen in einzelnen Ländern und dass nicht jede erlernte Kompetenz messbar ist) ist absolut richtig!
Es sind solche Artikel, die verhindern, dass ich vollends zum Griesgram werde. Danke dafür. Und auch ich hoffe, dass aus dem sächsischen Jungen was wird.
Unsere Tochter geht als Halb-Japanerin samstags auf die japanische Schule. Dort wird nach dem offiziellen japanischen Lehrplan Japanisch und Mathematik unterrichtet. In Mathematik ist man dort in der 1. Klasse unserer deutschen 2. Klasse dicht auf den Versen. Unsere Tochter kann bereits die ersten 100 von mehreren Tausend Schriftzeichen, die sie in den folgenden 11 noch lernen muss. Murrend paukte unsere Tochter die Schriftzeichen täglich. Wir haben aber nicht aufgegeben. Inzwischen “malt” sie sie mit einer Begeisterung, wofür sie von allen Seiten Bewunderung erntet. Ich hoffe, unser deutsches Bildungssystem und die allgemeine permissive Haltung hierzulande wird meiner Tochter die Freude am “Pauken” nicht vergraulen. Übrigens müssen die Kinder bereits gespitzte Stifte in die Schule mitbringen, damit keine Zeit mit unnötigen Dingen vertan wird! Ein Besuch in der japanischen Samstagsschule für unsere Lehrer, unser Kultusministerium und mancherlei Eltern ebenso, könnte ihnen die Augen öffnen, wie Schule zu funktionieren hat und dass dabei keineswegs gleichgeschaltete, verkorkste Kinder entstehen.
Sehr geehrter Herr Esser, nach 40 Jahren Schuldienst am Gymnasium, zuletzt 26 Jahre als Direktor eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums, möchte ich Ihnen sagen: Zustimmung in fast allen Punkten, nur in einem nicht: Sie sollten PISA nicht so ernst nehmen. Dieser Test ist – entgegen dem, was die interessierten Test-Institute dazu sagen – trainierbar; er testet ein paar Fertigkeiten, die mehr oder weniger mit schulischem Lernen zu tun haben, und das war es denn. Wirklich aussagekräftig sind Beobachtungen, die Sie so en passant nennen, die aber zeigen, dass Bayern und Sachsen tatsächlich weit vorn liegen: Dort stehen Lernen und Unterrichten im Mittelpunkt, dort wird mehr und gründlicher gelernt als anderswo. Dort ist die ganze Projektwirtschaft – von Ihnen treffend als „Blasen“ bezeichnet – ein Randphänomen. Daher kommen die schlimmen Rückstände – in den Lerninhalten(!) – der Schüler, die aus einem der rot-grünen Länder nach Sachsen kommen. Übrigens eine Episode dazu, die mir Sachsen ein Leben lang sympathisch gemacht hat. Es war während einer Sitzung einer Konferenz, an der Schulleiter von Gymnasien aus dem ganzen Bundesgebiet teilnahmen. Zugegen war der Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium. Aus Gedankenlosigkeit rutschte ihm das Wort von der „Entrümpelung der Lehrpläne“ heraus. Ich fuhr zornig auf und sagte ihm, dass dieses Wort ehrenrührig sei; unsereiner habe im Laufe seiner Dienstzeit sicherlich viele Fehler gemacht, aber niemals hätte ich den Kopf meiner Schüler mit Gerümpel angefüllt. Ob er denn wisse, was so alles unter den Begriff des Gerümpels in diesem Zusammenhang falle, u.s.w.. Was tat der Mann? Er hielt inne, dann entschuldigte er sich und versprach, diesen üblen Begriff niemals mehr zu verwenden. Chapeau!
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.