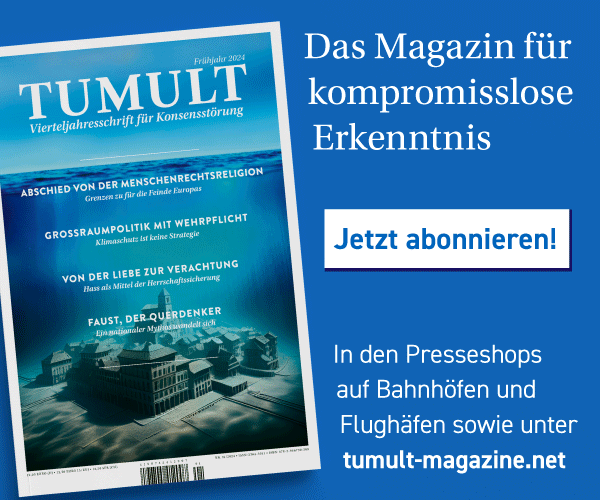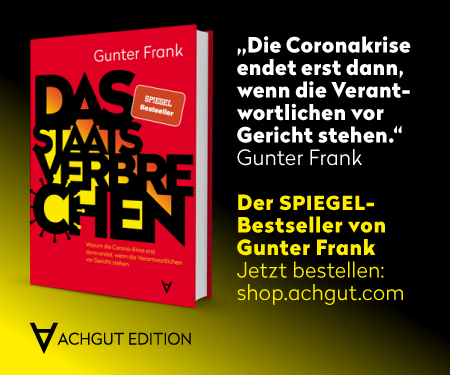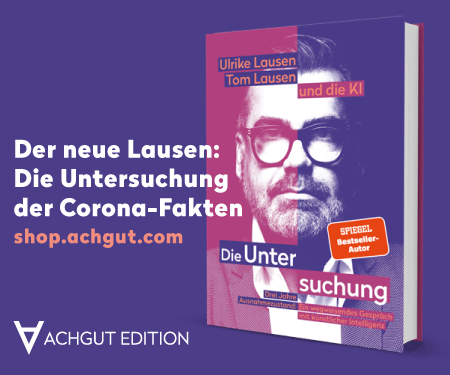Ist Intelligenz genetisch bedingt oder bildet sie sich aufgrund von Umwelteinflüssen und Erziehung? Wenn in Familien der Unterschicht, insbesondere in denen mit Migrationshintergrund, mehr Kinder geboren werden als in Akademiker-Haushalten – ist dies für die Gesellschaft der Zukunft von Nachteil, gar eine Gefahr für sie? Diese beiden Fragen bestimmen seit vielen Monaten weite Teile der Feuilletons der Republik. Die Achse des Guten bringt einen ganz neuen Aspekt in die Debatte: Ein Rückblick darüber, wie ausgerechnet in der DDR darüber geforscht und gedacht wurde, und vor allem wie damals dort die Politik damit umging, fördert erstaunliches zu Tage. Er lässt den Standpunkt des linken Spektrums in diesen Fragen in einem ganz neuen Licht erscheinen.
Wir starten zu dieser brisanten wie bisher unbekannten Seite der sogenannten „Sarrazin-Debatte“ heute eine dreiteilige Serie von Ulli Kulke.
Teil 1: Wie die DDR ihre Familienpolitik darauf ausrichtete, dass besonders Studenten viele Kinder bekommen.
Teil 2: Was in der DDR hinter den Kulissen in der Intelligenz-Forschung zur Frage „vererbt oder anerzogen?“
Teil 3: Der Stand der Intelligenz-Forschung heute: Gene versus Umwelt?
Von Ulli Kulke
Die Debatte um das Buch „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin brodelt weiter. Von einer Feststellung des Autors fühlen sich seine Kritiker besonders provoziert: Die demografischen Aussichten seien hierzulande deshalb düster, weil die falschen Eltern die meisten Kinder bekämen, die Angehörigen der Unterschicht nämlich. Sarrazins Befürchtung: So werde der Bildungsnotstand im Lande für die kommenden Jahrzehnte verfestigt. Ein Kapitel hat er denn auch fordernd überschrieben: „Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist“.
Einen Aufschrei in der eigenen Partei erntete der Dissident dafür, einen noch lauteren in der Linken. Von Eugenik war die Rede. Dabei hatte die SPD-Politikerin Renate Schmidt vor Jahren genau dieselbe Sorge wie Sarrazin öffentlich geäußert, und als Familienministerin genau zur Abhilfe das staatliche einkommensabhängige Elterngeld eingeführt. Mehr Grund aber als SPD-Politiker hätte die Partei der Linken, ihre Breitseiten gegen Sarrazin zu überdenken. Familienförderung zugunsten der Elite, Eugenik (wenn dieser Begriff denn hier zutrifft) – alles schon mal da gewesen. Nein, auch nach dem Krieg. Und zwar in der DDR. Ausgerechnet. Unter dem Anspruch der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“.
Anfang der 70er Jahre dämmerte es den Bildungspolitikern in der SED, auch den Experten etwa in der Akademie der Wissenschaften der DDR sowie dem Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ) an der Universität Leipzig: Der Geburtenrückgang in Ostdeutschland war systemgefährdend. Innerhalb von nur acht Jahren, zwischen 1965 und 1973, war die Zahl von Neugeborenen je 10?000 Frauen im gebärfähigen Alter von 65 auf 52 gefallen - um rund ein Viertel. „Besonders wenig steuerte die Intelligenz zur Reproduktion bei“, erinnert sich der Sexualwissenschaftler und Soziologe Kurt Starke, damals Forscher am ZIJ. „Hochschulabsolventinnen kriegten nicht nur später, sondern auch seltener Kinder als andere.“ Fünf Jahre nach Studien-Ende lagen im Jahre 1972 die meist 28-jährigen Akademikerinnen mit statistischen 1,2 Kindern „weit unter dem DDR-Durchschnitt“, schrieb Starke in einem Aufsatz für das Buch „Studieren mit Kind“. Zahlen, die aus heutiger bundesdeutscher Sicht kaum ungewöhnlich klingen, alarmierten die damaligen Bevölkerungspolitiker der DDR.
1972 begannen Partei und Regierung gegenzusteuern. Ab 1. Juli galt deshalb in der gesamten Republik eine „Anordnung zur Förderung von Studentinnen mit Kind und werdenden Müttern, die sich im Studium befinden“ - für Starke ein „Paradigmenwechsel“. In den fünfziger- und frühen 60er Jahren stand eher die konsequente Begünstigung der Arbeiter und ihrer Familien im Vordergrund. Das Studium galt als gesellschaftlicher Auftrag und war deshalb möglichst konsequent und ohne private Ablenkung durchzuziehen. „Wer doch auf den Gedanken kam, eine Familie zu gründen“, meint Starke, „wurde schnell als jemand betrachtet, der das Studium, seine ‚Klassenpflicht’, wie es hieß, nicht ernst nahm, und kleinbürgerlicher Haltungen verdächtigt.“ Damit war es nun vorbei.
Die Summen, mit denen Partei und Regierung ab sofort den Studentinnen Schwangerschaften und Mutterglück erleichterte, mögen heute nicht erheblich klingen. Doch im Vergleich zum Durchschnittseinkommen des Jahres 1970 in der DDR von 755 Mark und besonders auch zum damaligen Grundstipendium von 190 Mark monatlich, mit dem kinderlose Studenten ihr Leben finanzieren mussten, waren die neuen Zuwendungen speziell für Hochschüler nach der Geburt eines Kindes ein wahrer Geldsegen. Ein Studentenpaar, sofern beide Teile erziehungsberechtigt waren, konnten da zusätzliche 200 bis 300 Mark pro Monat erhalten, zuzüglich eventueller Sonderstipendien. War eine Unterbringung in der Krippe nicht möglich, kamen für das Kind noch mal 125 Mark dazu. Erheblich geringer dagegen fiel in dem „Arbeiter- und Bauernstaat“ das Kindergeld für das Proletariat aus nach dem ersten und zweiten Kind: 20 Mark monatlich, und einmalig bei der Geburt 1000 Mark – allgemeine Zuwendungen, die allen Studenten obendrein auch noch zustanden. In den 80er Jahren erhöhten sich die Geburtsprämien für Studenten noch einmal.
Doch dies war bei Weitem noch nicht alles. Neben finanzieller Besserstellung genossen Mütter im Studium und ihre Partner weitere Privilegien. Nach der Regelung von 1972 ging es um „eine besondere Unterstützung“, um günstige „Arbeits- und Lebensbedingungen der Studentinnen mit Kind bzw. von Studentenehepaaren mit Kind“. So bekamen sie in der notorisch an Wohnungen unterversorgten DDR bevorzugt Zimmer in Studentenheimen und in den 80er Jahren sogar zunehmend eigene Wohnungen, wovon andere im gleichen Alter nur träumen konnten. Auch das gesamte Umfeld an der Universität, der Lehrkörper, die Betriebe, in denen die Praktika absolviert wurden oder die die fertigen Studentinnen übernahmen, waren staatlicherseits angehalten, sich einzustellen auf die Probleme, die spontanen Unpässlichkeiten und die durch das Kind vorgegebenen Tagesabläufe der angehenden oder jungen Intelligenz-Mütter. Auszeiten, Fehltage, verkürzte Arbeits- und Studienzeiten – alles wurde toleriert.
Die Maßnahmen wirkten heftig und schnell, wie Starkes Statistik zu entnehmen ist: Danach waren noch 1969 an einer großen Universität wie der Leipziger am Ende des dritten Studienjahres (im Alter von etwa 21 Jahren) drei Prozent der Studentinnen Mütter und acht Prozent ihrer Kommilitonen Väter. Bereits 1974 waren es laut einer ersten Erhebung in der gesamten DDR 20 beziehungsweise 24 Prozent, 1986 dann 33 und 43 Prozent.
Zur Wendezeit hatten die Akademikerinnen der DDR ihre gering qualifizierten Landsleute bei den Geburten abgehängt – von ihren eigenen Standeskollegen im Westen ganz zu schweigen. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 1994 – vier Jahre nach der Wende - waren in den neuen Bundesländern nicht mal acht Prozent der Akademikerinnen zwischen 30 und 39 Jahren kinderlos, bei den ungelernten und angelernten Gleichaltrigen waren es rund 12 Prozent. Entgegengesetzt stellte sich die Situation in den alten Bundesländern dar: Über ein Drittel der 30- bis 39-jährigen Universitätsabsolventinnen im Westen waren kinderlos, bei den nicht oder gering qualifizierten Frauen dagegen weniger als ein Fünftel. Die DDR hat während der letzten zwei Jahrzehnte ihres Bestehens die eigene Bevölkerungspolitik offenbar auf die vornehmliche Vermehrung der geistigen Elite ausgerichtet. Nutznießer waren die Intellektuellen und ihre Kinder. Oder war es der ganze Staat und seine Bevölkerung? Eine schwierige Frage.
Nicht leichter allerdings ist die Frage nach den genauen Beweggründen, die hinter dem so wirksamen Programm standen. Anhaltspunkte für Vermutungen finden sich allerdings. Hat hinter der Familienpolitik à la DDR die Vermutung gestanden, Studentinnen würden intelligentere Kinder zur Welt bringen als die Arbeiterklasse?
Ende Teil 1
Im zweiten Teil lesen Sie, was in der DDR in der Intelligenz-Forschung zur Frage „vererbt oder anerzogen?“ hinter den Kulissen ablief.