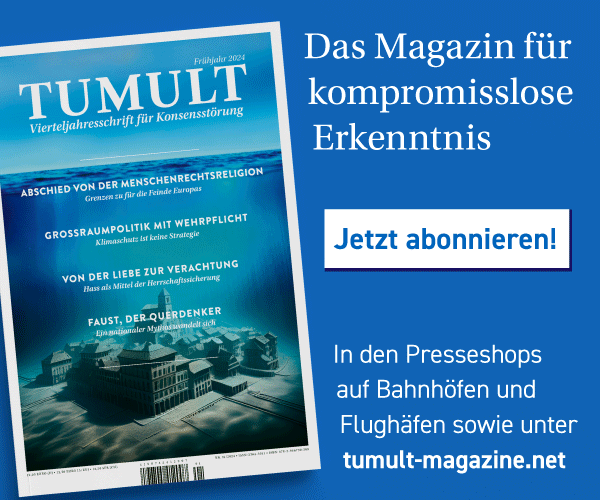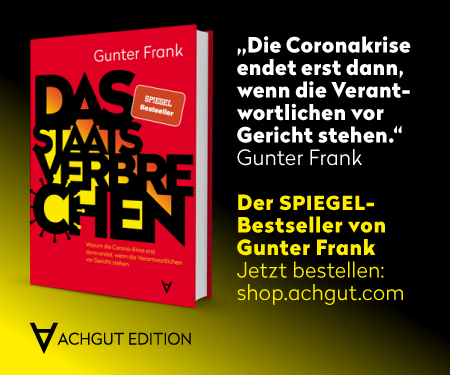Von Sebastian Hillmann.
In Zeiten des Corona-Wahnsinns wird man mit einer Flut von Informationen, auch solcher, die nicht die medizinischen Aspekte, Infektionszahlen und Engpässe bei der Versorgung mit medizinischem Material behandeln, regelrecht bombardiert.
Als geneigter Leser der „Achse“ und anderer unabhängiger Online-Medien und als interessierter Beobachter der insgesamten Berichterstattung in den Medien fällt mir auf, wie viele vermeintlich unscheinbare Berufe und Branchen aktuell mit dem Stellenwert betrachtet werden, der aufgrund ihrer Unverzichtbarkeit für die Gesellschaft eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Über Mediziner, Pflegepersonal, Rettungskräfte, Supermarkt-Mitarbeiter und viele mehr wurde und wird berichtet, als ob erst jetzt bekannt würde, dass diese Tätigkeiten für eine funktionierende Gesellschaft elementar sind. Meine Aufzählung ist nicht im Ansatz vollständig, denn es gibt noch viele andere Beispiele von Menschen, die „den Laden am Laufen halten“ und erst jetzt, in Krisenzeiten, sichtbar zu werden scheinen.
Ob es an meiner subjektiven Interpretation liegt oder an meiner persönlichen Beziehung zu dieser Berufsgruppe: Eine der tragenden Säulen der Versorgungssicherheit erfährt ebenfalls nicht diese Aufmerksamkeit – die Transportbranche. Vor zehn Jahren habe ich mich im Alter von 25 Jahren mit meinem Geschäftspartner im Bereich Straßengüterverkehr mit einem Speditionsunternehmen selbstständig gemacht und möchte hier meine Einschätzung zu diesem wenig beachteten Teil unserer Wirtschaft schildern.
Liberalisierung auf Kosten der einheimischen Transportbranche
Mit dem Wegfall der Bindung an die Beförderungstarife 1994 wurde der Markt für den Straßengüterverkehr, mit dem Ziel, mehr Wettbewerb zu schaffen, liberalisiert. Seitdem gilt nicht mehr der auf Zonen beziehungsweise Entfernungen beruhende und vom Gesetzgeber fixierte Tarif, sondern Vertragsfreiheit wie in vielen anderen Branchen auch.
Infolgedessen kam es zu einem Überangebot an Transportkapazitäten und zu einem starken Rückgang der Frachtraten. Im Jahr 2000 gab es in Deutschland 59.301 Unternehmen im gewerblichen Güterverkehr (Quelle BAG), nach letzter einsehbarer Statistik waren es im Jahr 2015 noch 45.051 Unternehmen. Die Entwicklung ist seitdem weiter rückläufig.
Mit der Einführung der LKW-Maut 2005 und den folgenden Erhöhungen und Ausweitungen auf mittlerweile alle Bundesstraßen haben sich die Kosten für alle betroffenen Unternehmen, ohne Berücksichtigung der Mautausweitungen bis heute von 0,10 Euro/km auf 0,187 Euro/km (87 Prozent) (exemplarisch: schwerer LKW >18t, EUR 6-Norm), erhöht. Diese Erhöhungen konnten nur teilweise an die Kunden und letztendlich auch die Endverbraucher weitergegeben werden.
Mit der EU-Osterweiterung 2004 und dem Ende der Übergangsfristen 2009 ist die Landkabotage (die Erlaubnis für alle in der EU ansässigen Transportunternehmen, Gütertransporte auch innerhalb der einzelnen Mitgliedsstaaten durchführen zu dürfen) für alle neuen Mitgliedstaaten uneingeschränkt möglich geworden.
Versorgungssicherheit? Ein Fundament mit Rissen
Die geschilderte Entwicklung führte binnen kurzer Zeit zu einer starken Zunahme von osteuropäischen Transportkapazitäten, vor allem im nationalen und internationalen Güterfernverkehr, sodass ein weiterer Preisverfall zu verzeichnen war und eine noch größere Konkurrenz auf die einheimischen Unternehmen ausgeübt wurde.
So wurden im Jahr 2007 noch 65,7 Prozent aller mautpflichtigen Kilometer durch in Deutschland zugelassene Fahrzeuge zurückgelegt, nach der letzten verfügbaren Jahresstatistik 2018 nur noch 58,3 Prozent. Der Anteil der durch im Ausland zugelassene Fahrzeuge stieg von bereits 34,2 Prozent in 2007 auf 41,7 Prozent in 2018.
Natürlich beinhalten diese Zahlen auch Kilometer, die für Transitfahrten durch Deutschland zurückgelegt wurden, jedoch veranschaulichen die absoluten Werte auch den Anteil der innerdeutschen Beförderungen, die mittlerweile von ausländischen Unternehmen erbracht werden. Dass diese Unternehmen mit geringeren Kosten kalkulieren können und demzufolge in der Lage sind, die nationale Branche zu unterbieten, versteht sich von selbst. Dies ist nicht nur im Güterverkehr, aber insbesondere dort der Fall.
Man hört dieser Tage oft Stimmen, die hinterfragen, inwiefern man sich abhängig gemacht hat von Importen existenzieller Waren. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von ausländischen Transportkapazitäten ist derweil Realität. Eine Versorgungssicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn auch in Ausnahmesituationen schnell verfügbare Transportkapazitäten in entsprechender Anzahl zur Verfügung stehen.
Die Leidtragenden sind die Kraftfahrer
Unter anderem durch das Stagnieren beziehungsweise Sinken der Frachtraten ist eine bessere Bezahlung der eigentlich ausführenden Berufsgruppe, nämlich die der heimischen Kraftfahrer, nicht oder nur sehr schwer möglich. Der „Kraftfahrermangel“ ist daher in der Branche nicht nur in aller Munde, sondern auch real seit Jahren eingetreten.
Politische Entscheidungen, wie die Aussetzung der Wehrpflicht, taten ihr Übriges. Alleine dort wurden jährlich rund 15.000 Fahrer ausgebildet. Der Beruf ist durch schlechte Bezahlung und mangelndes Ansehen in der Bevölkerung so unattraktiv geworden, dass der Altersschnitt bei den unter 25-Jährigen bei marginalen 2,7 Prozent, der der über 50-Jährigen bei 43 Prozent und der der über 55-Jährigen bei knapp 25 Prozent liegt.
Die „neuen Helden des Alltages“ schlagen sich derzeit neben zu schlecht bezahlter Arbeit, hohem Leistungsdruck und den anderen Entbehrungen, die die Arbeit als Kraftfahrer mit sich bringt, mit unhaltbaren Zuständen auf Rast- und Parkplätzen herum. Sanitäranlagen auf selbigen sind geschlossen, ebenso haben viele Verlader betriebseigene Toiletten und Duschen geschlossen, stattdessen werden auf Parkplätzen Dixi-Toiletten aufgestellt. Restaurants und Imbisse sind ebenfalls nicht geöffnet oder bieten nur „außer-Haus-Service“ mit langer Wartezeit an.
Trotzdem stehen jeden Tag, zu jeder Uhrzeit hunderttausende Kraftfahrer in ihrem Fahrerhaus auf und erledigen ihre Arbeit. Sie gewährleisten die Versorgung mit allem, was wir zum Leben brauchen. Neben allen anderen Beschäftigten des Gewerbes gebührt auch diesen Menschen unser Dank und vor allem die Wertschätzung ihrer unverzichtbaren Arbeit.
Frachten an Subunternehmer makeln
Leider ist eine Besserung der Lage für diese Gruppe und auch für die jetzt betroffenen kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht in Sicht. Große Logistik-Konzerne bedienen sich seit Jahren vor allem osteuropäischer Subunternehmer, um vor allem ihre Aufträge im Fernverkehr abzuwickeln.
Wie viele andere kleinere Unternehmen, muss auch unseres auf deutsche und osteuropäische Subunternehmer zurückgreifen, da der eigene Fuhrpark aufgrund der hohen Fixkosten keinen Gewinn erwirtschaften kann.
Ebenfalls sprießen seit Jahren sogenannte „Sofa-Speditionen“ wie Pilze aus dem Boden, die ohne eigenen Fuhrpark nach dem gleichen Schema wie die Großunternehmen Frachten an Subunternehmer makeln, oft zu unmöglichen Konditionen. Das „Hermes-Modell“, vor einigen Jahren groß in den Schlagzeilen, lässt grüßen. So traurig es ist, dieses Geschäftsmodell ist für viele Unternehmen zur Existenzgrundlage geworden.
Beispielsweise vermakelt eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG, und damit indirekt ein Unternehmen, an dem der deutsche Staat beteiligt ist, Frachtüberhänge, die nicht von fest gebundenen Subunternehmern befördert werden können, über Frachtbörsen zu Konditionen, die das Mindestlohngesetz der Lächerlichkeit preisgeben.
Diese Schilderungen geben nur einen kleinen Einblick in den Alltag einer Branche, die von der Politik nicht nur vergessen, sondern auch wie ein schmuddeliges Stiefkind neben den glänzenden Geschwistern Automobil-, Chemie-, Maschinenbau- und Elektroindustrie behandelt wird.
Perspektiven?
Wenn ich Verwandten oder Freunden von Zeit zu Zeit mein „Leid“ klage, werde ich gelegentlich gefragt, ob ich noch einmal den Schritt in die Selbstständigkeit, in dieses Haifischbecken namens Speditionsgewerbe tun würde. Seit Jahren beantworte ich diese Frage mit der Antwort, dass ich dies mit meinem heutigen Wissen nicht getan hätte.
Die Situation der Branche war auch vor den gravierenden politischen Entscheidungen, die im Zuge der Corona-Pandemie getroffen wurden, eine, untertrieben gesagt, herausfordernde. Von staatlichen Auflagen und Bürokratie, immer weiter steigenden Kosten und stagnierenden Frachtraten, über Fahrermangel und 12-Stunden-Arbeitstage: Welcher junge Mensch soll unter diesen Voraussetzungen noch die Motivation haben, sich in einem solchen Gewerbe selbstständig zu machen? Welcher Berufsanfänger soll motiviert werden, den Beruf des Kraftfahrers zu ergreifen?
Wohin kann dieser Weg in einer Gesellschaft führen, die es verlernt hat, die Notwendigkeit einer in allen Bereichen funktionierenden Wirtschaft nicht nur zu erkennen, sondern auch zu fördern? Man kann das Gefühl bekommen, das Leistungswille und -bereitschaft heute bestraft werden und paradoxerweise Leistungsverweigerung staatlich gefördert wird.
Wie soll aus unserer gepamperten Gesellschaft je ein Nachwuchs entstehen, der die Früchte der Arbeit vorhergehender Generationen nicht nur erntet, sondern auch erhält und weiterentwickelt? Wie soll man den vielen jungen Menschen klarmachen, dass staatliche Alimentierung nur das letzte Mittel sein sollte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten?
Und vor allem: Wie lange können wir es uns noch leisten, diese Fragen überhaupt zu stellen angesichts der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Konsequenzen des verordneten „Shutdowns“?
Heute kam die erste Mail eines größeren Kunden:
„Leider ist es bei uns auch soweit, dass wir mit Ihnen über die bestehenden Frachtpreise sprechen müssen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Bevor wir uns auf die Suche nach anderen Dienstleistern machen …“
Quo vadis, Germania?