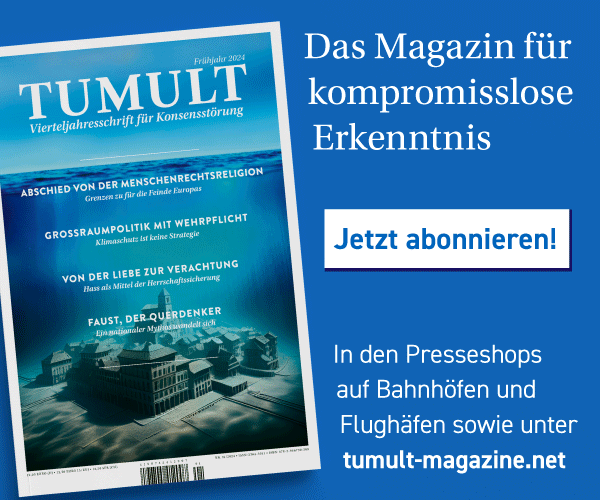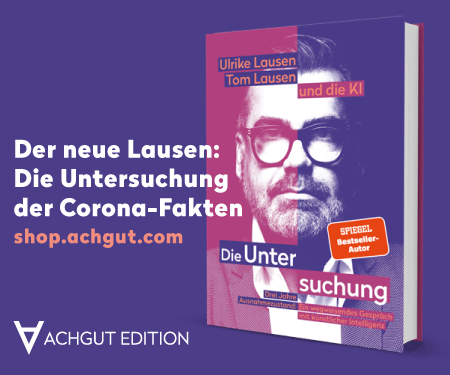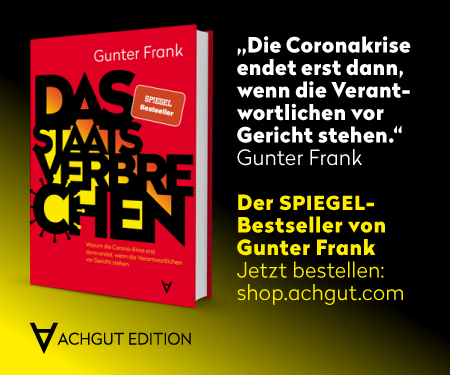-1.jpg)
Wehret den Anfängen! Jahrzehnte lang der Spruch der echten Anti-Faschisten, muss sich heute gegen seine unreflektierten Nutzer wehren, geschlagen Dummheit und Inkompetenz.
Solange grüne Ideologen das Sagen haben in Deutschland, wird sich nichts ändern. Die 68 er Generation hat Deutschland mit einer links-grüne Medienlandschaft verändert,die die Meinungshoheit an sich gerissen hat und leider keinen wirklichen Gegenpart hat. Die Bevölkerung ist so beeinflusst,sie merkt nicht,dass es bergab geht. Mit der AfD gibt es eine Partei,die versucht eine Umkehr einzuleiten, leider gibt es noch zu viel Personen in der Partei die den Medien Angriffsflächen bieten,die natürlich genüsslich ausgenutzt werden. Wichtig wäre,die CDU muss sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen,es muss ein/e neuer/neue konservative Führungspersönlichkeit den Mut haben,diesen Laden aufzuräumen und die Sozialdemokratisierung zu stoppen! Wenn Deutschland nicht wieder zur Ordnung und der Anwendung der Gesetze zurückkehrt,wird es ein böses Erwachen geben. Wir sollte nicht solange warten,denn,WER zu spät kommt,den bestraft das Leben!
Bei uns entscheiden Politiker über Dinge, von denen sie keine oder wenig Ahnung haben. Die Grünen tun sich da besonders hervor. Die posaunen den größten Quatsch als die einzige Wahrheit hinaus und die Medien verbreiten das dann auch noch unreflektiert. Aber was soll man sich groß aufregen. Die paar Leser und Kommentatoren können sich in ihrem kleinen Zirkel auskotzen. Die große Masse schert sich einen Dreck drum. Große Hoffnung, dass sich was ändert, sollte man nicht haben. Vielleicht hebe ich mir meine Leserbriefe zukünftig auf. Dann kann ich später wenigstens sagen: Ich kann nichts dafür.
Die ersten 98% Ihres Artikels leuchten ein. Das von seinen Risiken für die Steuerzahler in Deutschland praktisch nicht mehr reversible Euro-Experiment (Target 2, Quant. Easing, Kapitalmangel im Deutschland der späten 90er und frühen 2000er Jahre, Kaufkraftverlust für arbeitende deutsche Bürger zugunsten von Exportgewinnen von deutschen und ausländischen Kapitalgebern) i.H.v. mehreren Billionen (engl.: Trillions) Euro/USD lassen Sie dabei ausser Acht, reichen doch die anderen Themen (geförderte Massenzuwanderung von Analphabeten, Energiewende, Technik- und Bildungsfeindlichkeit, Alterung der Gesellschaft mit kaum noch tragbaren Pensionslasten ohne jede Vorsorge etc.), möglicherweise jedes für sich, schon aus, um der deutschen Wirtschaft den “Todesstoss” zu versetzen (also den Punkt zu überschreiten, an dem die erwirtschaften Einnahmen mitsamt der Kreditwürdigkeit nicht einmal mehr ausreichen, Recht und Ordnung in einem für eine moderne Gesellschaft erforderlichen Ausmaß aufrecht zu erhalten). Doch was ich überhaupt nicht verstehe, sind die letzten 2%: >>Doch der innerste Antrieb des Menschen ist sein Überlebenswille. Wird dieser massenhaft tangiert, und merkt die Mehrheit dann, wie schlecht es eigentlich steht, kann das Umdenken sehr schnell erfolgen – man sagt dann „die Stimmung kippt“.<<. Nur ‘mal zu Ende gedacht: Zu dem Zeitpunkt, in dem die ca. 80% Schlafwandler erkennen, “wie schlecht es eigentlich steht”, wird es zu spät sein. Wie soll sich Ihrer Ansicht nach der “Überlebenswille” artikulieren, wenn Vermögen und Rente auf Null stehen und es für gesammelte Flaschen auch kein Geld mehr gibt, wenn plündernde Banden durch die Straßen ziehen und der noch verbleibende Reststaat sich darauf beschränkt, das Aufkommen von Bürgerwehren mit aller Gewalt zu verhindern, auch in Zusammenarbeit mit Kriminellen und daher erfolgreich? Plündern die dann auch, oder was?
Eine perfekte Ausführung, dass es so nicht weiter geht. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Eine Änderung über Wahlen dauert erstens zu lange und zweitens ist sie nicht möglich, so lange die Mehrheit der Menschen bereit ist, ihren eigenen Untergang zu wählen. Wer legt einen gangbaren Weg dar, welcher demokratieerhaltend etwas bewirkt, eine zügige Änderung ermöglicht, hier, auf der Achse, denn Kritk ist unverzichtbar notwendig und weit besser als nichts, hat aber keinerlei Wirkung auf Dummheit !
Jahrzehntelang haben sich die Parteien und die Verbände unseren Staat angeeignet. Sie wirken nicht an der Demokratie mit, sie machen sie zu einer Hure. Dem entsprechend wurden über Jahrzehnte auch die Positionen der Herrschaft nach dem Parteibuch vergeben und die Un-Eliten nach Gesichtspunkten der Anpassungsbereitschaft und Konformität ausgewählt. Übrigens geschah dies in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft. Ausbildung, Studium, Wissen, Berufserfahrung, etc. wurden zu drittrangigen Kriterien der Selektion. Auf dieser schon ausgehöhlten Grundlage konnte dann die 68er Generation von Desperados, Mitläufern und Vorteilsnehmern aller Art das Kommando übernehmen und die grün-bunte Gesinnungsherrschaft etablieren. Fortan werden neue Geschlechter eingeführt, Natur, Klima, Tiere und was auch immer gerettet, Fremde zu den neuen Heilsbringern erklärt sowie Bürger, Nation und Staat zu Auslaufmodellen deklariert. Diese Politik entspricht durchaus dem auf Hedonismus beruhenden Massenkonsum und einer zu globalistisch-kapitalistischen Herrschaftsformen neigenden Massendemokratie. Außer Blick bleiben die materiellen, kulturellen und geistigen Voraussetzungen dieses luxuriös ausgerichteten Paradieses auf Erden in Vergangenheit und Gegenwart. Übersehen werden auch die heftigen und sich abzeichnenden Verteilungskämpfe zwischen den Völkern und Kontinenten um Ressourcen. Die grün-bunten Utopien sind in ihrem Selbstvernichtungspotential kein Mittel der Selbstbehauptung, sondern einer großen Preisgabe, die man schon jetzt den Invasoren freiwillig übergibt.
Ein echter Lemming, der will am Ende immer zum Meer. Egal, was er sonst wahrnimmt während seines Lebens. Sind die heutigen Deutschen Lemminge? Zumindest scheint es so…bis jetzt!
>> “Selbstzerstörerischen Altruismus zum einzigen Wert erklärt” Daß Altruismus in letzter Konsequenz selbstzerstörend ist, und gesunder Eigennutz lebenswichtig, hat schon vor über 60 Jahren Ayn Rand erkannt…
Leserbrief schreiben
Leserbriefe können nur am Erscheinungstag des Artikel eingereicht werden. Die Zahl der veröffentlichten Leserzuschriften ist auf 50 pro Artikel begrenzt. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen beim Erscheinen von Leserbriefen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.