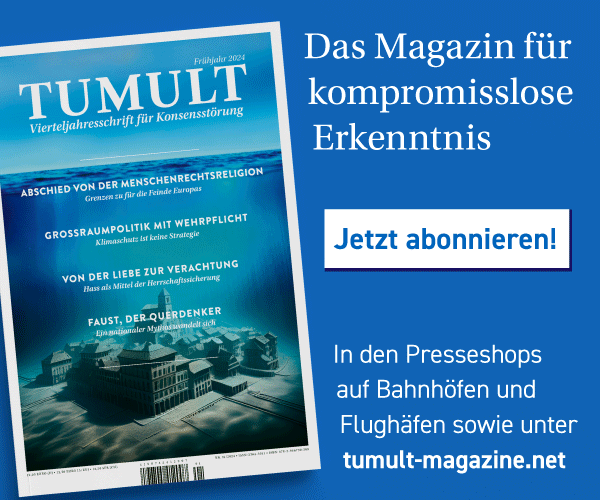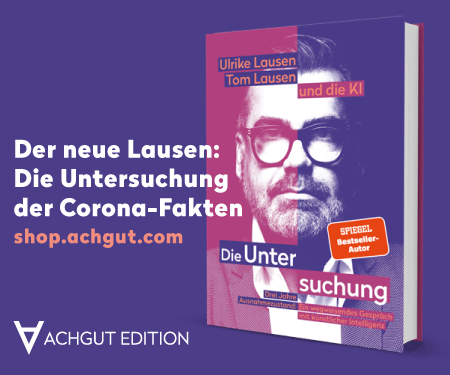Auf einem politischen Blog wie Achgut.com über Religion zu schreiben, mag auf den ersten Blick etwas deplatziert erscheinen, aber in einer Zeit, wo sich die Reden unseres Bundespräsidenten zunehmend wie das Wort zum Sonntag anhören und die Kanzlerin zu ihrem Volk in einer Sprache spricht, die doch sehr an einen Elternabend in einer ökumenisch-integrativen Kindertagesstätte erinnert, gibt es nicht zu übersehende Überschneidungen zwischen dem aktuellen Zustand organisierter Religion und der Fundamentierung oder besser Nichtfundamentierung von Politik, die Gedanken zur Religion nicht ganz abwegig erscheinen lassen.
Erst jüngst, bei der Verleihung des Augsburger Friedenspreises an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und den Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, konnte man eine kuschelige Nähe zwischen Politik und Kirche sehen. Das Preisverleihungsmenuett zwischen Presse, Staat, Wirtschaft und Kirche funktioniert ja blendend, wie es scheint, und schließt nur allgemein anerkannte Ketzer und Kritiker konsequent aus.
Dabei sinken Auflagen und Einschaltquoten der beteiligten Medien, in der Politik macht sich nicht erst seit gestern Verdrossenheit breit, und den Kirchen laufen die Schäflein davon, in Scharen geradezu, was sich schon im Klingelbeutel bemerkbar macht. Gut, dass es da sowohl für die Medien die Demokratieabgabe und für die Kirchen die staatlich betriebene Kirchensteuer und die Möglichkeit, an den Zitzen des Sozialstaats zu saugen, gibt.
Jeder Satansbraten wird zu Gottes Kind
Die gemeinsamen Werte von Staat und Kirche sind klar: Internationalistische Fernstenliebe und ein Verweis auf die „Werte“, die es gegen ihre Feinde zu verteidigen gilt, wobei der Begriff „Werte“, wie ein verdünnter Aufguss dessen wirkt, was einst mit der Androhung von Höllenstrafen bewehrter Moralkodex war. Hölle und Fegefeuer sind ja eh abgeschafft, beziehungsweise haben sich ins Nirgendwo verflüchtigt: Es wird ja nur noch Heil und Freude verkündet, abgesehen von Friede und Dinkeleierkuchen; mit so etwas Unangenehmem zu kommen, wie dass die frohe Botschaft auch einige unfrohe Züge hat, das mag man sich nicht mehr leisten. Fast wie in der modernen Pädagogik fehlt es an strafbewährten Grenzen, jeder Satansbraten wird zu Gottes Kind, und die Zahl der Backen zum Hinhalten hat sich vermehrt wie Brot und Fische weiland am See Genezareth.
Anfang Oktober diese Jahres war ich für eine Woche in Venedig: Blauer Himmel, türkise Kanäle mit tatsächlich Fischchen drin, keine Kreuzfahrtschiffe und kaum außereuropäische Touristen. Natürlich geht man gelegentlich in eine Kirche, die es ja buchstäblich fast an jeder Piazza gibt. Irgendein Tintoretto oder Tizian ist immer drin. Nun ist es so, dass mich in diesen Kirchen fast immer ein eigenartiges Gefühl von Depressivität befällt. Das beschränkt sich nicht auf italienische, grundsätzlich taucht überall diese undefinierbare Trauer auf, die sicher damit zu tun hat, dass ich den kirchlichen Raum als eine Schale ohne Inhalt erlebe: Schön, aber auch im Zustand der Dekomposition, funktionslos und selten nur erfüllt von der schwer zu qualifizierenden Aura, die ihn wohl einst angefüllt hat. Museum eben und Museen kann man als Gefängnisse von Artefakten beschreiben.
Schon der Impuls aber, diese Bauten hinzustellen, muss ein ungeheuer zwingender gewesen sein. Aus rein rationalen Überlegungen heraus macht man das nicht, und auch die in Venedig überdeutlich sichtbare Verquickung von Staatideologie und Religion erklärt nur einen Teil des Aufwands, der da betrieben wurde. Natürlich deutet schon der fast hysterische Bombast gegenreformatorisch-barocker Malerei auf eine gewisse innere Entleerung der Bilder hin, aber die aufgewendete Energie war ungeheuer. Und heute: Alles ein Objekt für fotografierende Flaneure, nur zweimal kam ich zufällig in eine Messe.
Das erste Mal mit vielleicht 20 Teilnehmern in der riesigen Basilika Santa Maria della Salute (auch hier zelebrierte übrigens kein einheimischer Priester mehr, die Inder und Afrikaner haben übernommen), dann noch einmal in der relativ vollen Kirche auf der Venedig vorgelagerten Insel Burano. Ich wunderte milch schon und vermutete, dass in eher ländlichen Zonen der Kirchenbesuch häufiger sein könnte, aber der Gottesdienst entpuppte sich als Beerdigung: Hochzeiten und Trauerfeiern scheinen das „piece de resistance“ der kirchlichen Zeremonien zu sein. Das ist in Bayern nicht anders.
Nicht anders als Fridays for Future
Man kennt das Phänomen, dass einem, denkt man über ein Thema nach, wie durch Zufall Bücher oder Artikel oder Situationen „zufallen“, die mit dem Problem in Verbindung stehen. Der erste „Zufall“ war ein Artikel in der NZZ von Alexander Kissler vom 11.10.2020 mit dem Titel „Die Politisierung der Kirchen schadet diesen selbst am meisten“. Kissler sieht die beiden deutschen Großkirchen auf dem Weg zu weltlichen Nichtregierungsorganisationen.
Man merkt das schon an der Sprache ihrer Funktionseliten: So schreiben in einer Erklärung zum 30. Jahrestag der Einheit der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und der Konferenzvorsitzende Georg Bätzing: „In Deutschland und Europa vereint uns in föderaler Vielfalt der demokratische Geist einer verantwortungsvollen Gestaltung von Gesellschaft in Freiheit und Pluralismus. (...) Unsere Einheit in Vielfalt erfordert unbedingten Respekt voreinander, verständnisvolles Interesse füreinander und gelebte Solidarität untereinander.“
Mir zumindest kommt der Verdacht, dass hier nur noch Floskeln und irrelevante Allgemeinplätze verlautbart werden. Kissler deutet das so: „So klingt es, wenn staatsfromme Funktionäre zu sich selber reden. Die politisierte Kirche ist auch eine Funktionärskirche. In ihr sind die Grenzen fließend zwischen politischem Aktivismus und geistlicher Sorge. Bätzing rühmt der neuen Enzyklika nach, der Papst setze sich 'für Chancengerechtigkeit, soziale Inklusion und Teilhabegerechtigkeit' ein. Nicht anders redet ein sozialdemokratischer oder linker Kommunalpolitiker – oder Fridays for Future.“
Dabei steht laut Kissler die theologische Beliebigkeit des gegenwärtigen kirchlichen Lehramts in seltsamem Kontrast zu politischer Parteinahme. „Wie der Teufel das Weihwasser meiden die Kirchen alle theologische Widerborstigkeit und jedes spirituelle Wächteramt. Statt geistiger Wegzehrung gibt es politische Lektionen. Im Kernbereich christlicher Verkündigung ist die Hasenpfötigkeit Programm. Für viele Amtskollegen sprach der katholische Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, ein 'belehrendes oder gar autoritäres Reden und Verkünden von Gott' verbiete sich. In politischen Fragen jedoch gibt es keine kirchliche Obergrenze für Belehrungen jedweder Art.“
Ein Moralgeplapper, das auf keinen Fall die eigenen Ressourcen teilt
Die Leidenschaft, für politische Vorhaben zu kämpfen, stehe dabei in merkwürdigem Kontrast zur Betroffenheitsroutine, mit der die Kirchen den Abbruch der religiösen Praxis, den Kollaps der christlichen Bildung und den Exodus der Gläubigen zur Kenntnis nehmen, meint Kissler und deutet Statements aus einem Treffen zwischen SPD und EKD („EKD und SPD stehen gemeinsam für Weltoffenheit und Toleranz und machen sich stark gegen Hass und Hetze. ... Gerade jetzt gilt es, sich den Feinden der Demokratie entgegenzustellen und Farbe zu bekennen für unsere demokratischen Werte, zum Erhalt unserer pluralistischen Gesellschaft.“) als ein neues, sich abzeichnende Bündnis zwischen Thron und Altar. Der eigentliche, ja nur individualistisch fassbare und vollziehbare Glaube entleert sich in Richtung eines Moralgeplappers, das auf keinen Fall meint, die eigenen Ressourcen zu teilen – wie weiland der heilige Martin den Mantel. Die Rechnung für die eigenen moralischen Forderungen werden in der Regel beim Steuerzahler abgeladen.
Kissler geht noch eine Etage tiefer in seiner Kritik:
„Bei Franziskus und vielen ökumenischen Geschwistern wird deutlich, woraus die Flucht ins Politische sich letztlich speist: aus Kulturpessimismus. Die politisierende ist auch die panische Kirche, die sich die Gegenwart in düsteren Farben malt. Der Papst fordert einen aktiven, präsenten Staat und 'wirksamere Weltorganisationen', damit diese einer 'kranken Gesellschaft' und dem 'moralischen Zerfall' Einhalt gebieten. Weltliche Akteure sollen einer universalen Moral zum Durchbruch verhelfen. Mehr als eine ideologische Anschubfinanzierung trauen sich die Kirchen nicht zu. Ihren größten Gegner kennen sie. Ein abgründiger Satz in 'Fratelli Tutti' behauptet, radikaler Individualismus sei 'das am schwersten zu besiegende Virus'. Nicht nur in Corona-Zeiten kann man diese Aussage abgeschmackt finden. Sie wirft ein grelles Licht auf das Grundproblem der Politkirchen: Sie misstrauen dem Menschen.“
Ich selbst bin vor ungefähr 40 Jahren aus der Kirche ausgetreten. An den Grund kann ich mich noch gut erinnern: In einer Diskussionsrunde im Fernsehen wurde eine Putzfrau, so hieß das damals, gezeigt, die wegen Wiederverheiratung ihre Stelle in einem katholischen Kindergarten verlor. Gleichzeitig erzählte mir ein Freund, dass in einem unserer Bistümer anstandslos die Alimente für vier uneheliche Kinder eines Pfarrers gezahlt würden. Nachgeprüft habe ich das nicht. Ich rannte sozusagen wutentbrannt zum Gemeindebüro, um meinen Austrittszettel abzuholen. Nach meiner Begründung gefragt, führte ich sie an. Der Priester schob mir den Wisch ohne weitere Diskussion rüber. Die Situation war ihm sichtlich peinlich.
Mein inneres Gretchen
Ich kann insgesamt nur annehmen, dass der Funktionselite unserer Kirchen die Gläubigen eigentlich egal sind. Diskussionen um Zölibat und Frauenordination laufen regelmäßig ins Leere, obwohl offensichtlich zum Beispiel für den Zölibat keinerlei Begründung in den kanonischen Texten zu finden ist und seine Folgen geradezu grotesk sind.
Warum dann aber meine immer vorhandene Depressivität, wenn ich auf die Leere kirchlicher Räume und die Floskelhaftigkeit kirchlicher Rede stoße? Es gibt vielleicht nicht nur die Position des Faust in mir, sondern auch so eine Art inneres Gretchen: „Man muss dran glauben!“
Und: Ein ehemaliger Verfassungsrichter hat gesagt, die Demokratie könne nicht die Werte produzieren, auf denen sie beruhe. Wer aber dann?