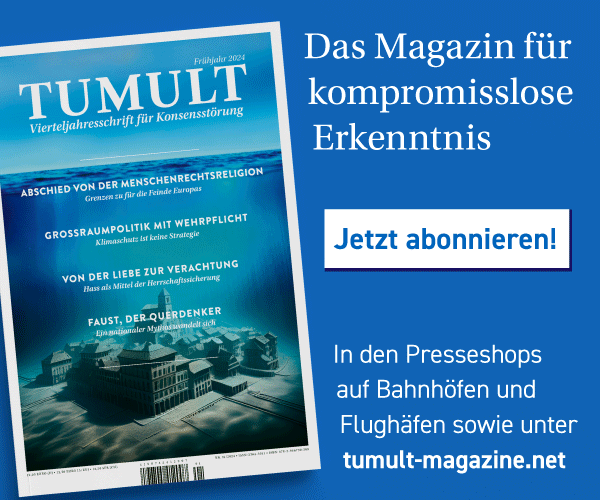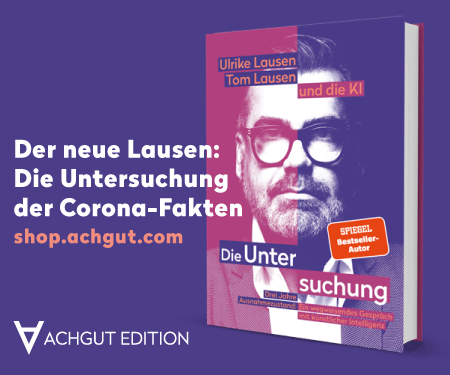Die Peter-Weiss-Stiftung in Berlin ruft Kulturinstitutionen, Theater und interessierte Personen zu einer weltweiten Lesung “in memoriam Anna Politkowskaja” auf, und zwar für den 20. März.
Die am 7. Oktober 2006 in Moskau ermordete Journalistin Anna Politkowskaja beschrieb in ihren Reportagen vor allem die Katastrophe des zweiten Tschetschenienkrieges. Ihre Texte schildern Folterszenen, rekonstruieren kaltblütige Morde, prangern den Zynismus von Bürokraten an, schildern das Leid und die Verzweiflung der Zivilbevölkerung, die zwischen Armee und Rebellen aufgerieben wird, und geben ein beklemmendes Bild vom Klima der staatlich geschürten Angst und Repression in Russland.
Für die Lesungen ist die Textauswahl “Machkety. Ein Konzentrationslager mit kommerziellem Einschlag” und “Sonderoperation Sjasikow” vorgesehen (aus: “Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg”, aus dem Russischen von Hannelore Umbreit und Ulrike Zemme, © 2002 Anna Politkovskaja, © 2003 DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln). Diese Textpassagen können am 20. März 2007 bei Bereitstellung eines Büchertisches honorarfrei verwendet werden.
Anmeldungen für eine Lesung “in memoriam Anna Politkowskaja” bitte senden an: info@peter-weiss-stiftung.de
BACKGROUND:
Anna Politkowskaja wurde als Tochter von sowjetischen UN-Diplomaten 1958 in New York geboren. Sie studierte an der Moskauer Universität Journalismus und arbeitete zunächst für verschiedene Zeitungen wie “Iswestja”, dann, seit dem Ende des kommunistischen Systems, für unabhängige Blätter, darunter die “Obschtschaja gaseta”. Seit 1999 war sie Sonderkorrespondentin der kleinen oppositionellen “Nowaja Gaseta”. Als im selben Jahr Putin Premierminister wurde und der sogenannte zweite Tschetschenienkrieg begann, konzentrierte Politowskaja sich auf diese eng miteinander zusammenhängenden Ereignisse und ihre unheilvolle Entwicklung, die sie in ihren Büchern “Tschetschenien: Die Wahrheit über den Krieg” (2002) und “In Putins Russland” (2004) schilderte.
Die kleine nordkaukasische Bergregion Tschetschenien hatte 1991 ihre Unabhängigkeit von Russland erklärt, die ihr im Friedensvertrag von 1996 – nach dem ersten Krieg, von dem die Medien noch frei berichteten – auch zugestanden wurde. Doch die Unabhängigkeit der abtrünnigen Kasachen wurde von russischer Seite weitgehend als Niederlage, wenn nicht sogar als bittere Schmach empfunden. Als 1999 ein tschetschenisches Kommando unter der Leitung von Rivalen des damaligen Präsidenten Maschadow in Dagestan auf russisches Gebiet einfiel, schien die russische Vorherrschaft im Nordkaukasus in Gefahr. Wenig später wurden in Moskau zwei blutige Sprengstoffanschläge verübt. Als Täter wurden bald Tschetschenen bezichtigt – ein Verdacht, der sich bis heute nicht erhärtet hat. Putin, damals Chef der KGB-Nachfolgeorganisation FSB, reagierte mit einer “Antiterror-Operation”, die den zweiten Tschetschenienkrieg auslöste. Als Antwort auf die “Demütigung” Russlands und als Versprechen, wieder Größe zu beweisen, nutzte Putin den Konflikt zu seinem politischen Aufstieg; so wurde er im Jahr 2000 zum Präsidenten der russischen Föderation gewählt.
Seitdem beobachten Organisationen wie “Reporter ohne Grenzen” eine zunehmende Auflösung bzw. Gleichschaltung der seit dem Untergang der Sowjetunion weitgehend freien und unabhängigen Medien in Russland. Wirtschaftliche Einflussnahme kremlnaher Netzwerke, bürokratische Behinderung und ein Klima der Bedrohung sorgten dafür, dass Russland auf der “ROG-Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit” auf Platz 140 (von 167) steht. Aus Tschetschenien ist nach wie vor keine freie Berichterstattung möglich.
Seit den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 gab Putin zwar solidarische Lippenbekenntnisse zum internationalen Krieg gegen den Terrorismus ab, aber sie dienten nur außenpolitischen Ablenkungsmanövern von seiner sinistren innenpolitischen Agenda. Im selben Jahr wurde der Krieg in Tschetschenien offiziell für beendet erklärt. “Putin begann zu versuchen”, erklärte Anna Politkowskaja in einem Interview mit dem “Guardian”, “der Welt zu beweisen, daß er gegen internationale Terroristen kämpfte, daß er nur Teil eines allgemein gebilligten Krieges war. Und er hatte Erfolg. Es war widerwärtig, als er zu erklären begann, dass wir bei der Geiselnahme in Beslan buchstäblich die Hand Bin Ladens sehen. Was hat Bin Laden damit zu tun?”
In ihrer Berichterstattung stellte Politkowskaja dar, dass der Krieg noch nicht beendet war, sondern daß Gewalttaten und Menschenrechtsverletzungen unvermindert anhielten. Sie konzentrierte sich dabei besonders auf die Leiden der Zivilbevölkerung, die zwischen den kämpfenden Parteien aufgerieben wird, erhellte die perversen Mechanismen des Krieges, exponierte die Bedingungen, unter denen diese funktionieren, und prangerte die Nutznießer an.
Für ihre Arbeit wurde Anna Politkowskaja mit zahlreichen Preisen geehrt. 2003 erhielt sie den ersten “Lettre Ulysses Award” für die beste Reportage sowie die “Hermann-Kesten-Medaille”. 2004 wurde sie mit dem “Olof-Palme-Preis” geehrt, und ein Jahr später wurde ihr der “Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien” verliehen. In Russland erhielt sie 2001 den “Preis der Journalistenunion”. In ihrem Heimatland sah sie sich aber auch eskalierenden Einschüchterungsversuchen und Drohungen ausgesetzt. Doch einen Leibwächter lehnte sie ebenso ab wie die Flucht ins Exil. Nachdem sie bereits 2004 Opfer eines Giftanschlages geworden war, erschoß sie am 7. Oktober 2006 ein unbekannter Täter im Aufgang ihres Moskauer Wohnhauses. Die Unterlagen zu ihrem letzten Artikel verschwanden. Anna Politkowskaja hinterlässt zwei Kinder.